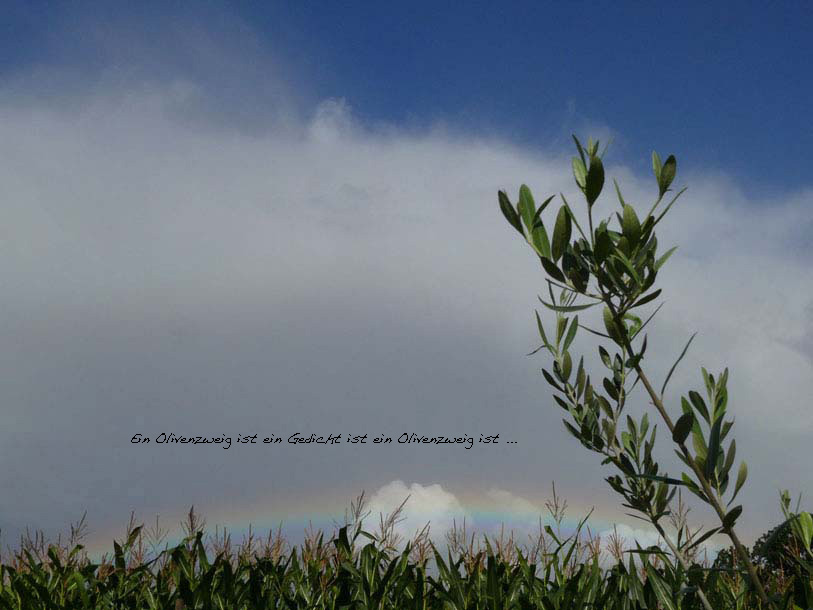Eine kleine Geschichte des
Olivenanbaus in Deutschland
von Hartmut Schönherr - 12. Juni 2010
Olivenanbau in Deutschland? Nun, die Klimaerwärmung hat dazu
beigetragen, dass dieses Thema heute nicht mehr ganz so
absurd klingt. Und Suchmaschinen liefern auf die Anfrage
"Olivenhain Deutschland" bereits einige entsprechende
Projekte - darunter mein auf den folgenden Webseiten mit
vorgestelltes.
Wer sich mit dem Klimawandel beschäftigt, der kommt
zwangsläufig auch mit der Klimageschichte in Berührung. Und
erfährt zum Beispiel, dass zur Römerzeit die Alpen bis in
Höhen von 2800 Meter gletscherfrei waren - was Hannibals Zug
überhaupt erst ermöglichte. In Mitteleuropa dürften daher
die Winter insgesamt milder gewesen sein noch als heute. Das
römerzeitliche Klimaoptimum dauerte von der Augustuszeit bis
ins 4. nachchristliche Jahrhundert.
Da liegt der Verdacht nahe, dass in der Antike der eine oder
andere heimwehkranke römische Gutshofbesitzer in den
Provinzen Germania Superior und Germania Inferior einen
Olivenbaum von "zuhause" in seinen Ländereien oder beim
Wohnhaus gepflanzt hat. Auch wenn das römische Reich sein
Olivenöl vor allem aus Spanien und Nordafrika (Tunesien)
bezog, war die in engerem Sinne "heimische" Produktion nicht
unbedeutend - immerhin empfiehlt M.P. Cato in "De agri
cultura" 150 v. Chr. (Datum umstritten) seinen Landsleuten
den Olivenanbau auch in Italien als hoch profitabel.
Olivenhaine in nennenswertem Umfang dürften in den
germanischen Provinzen jedoch nicht existiert haben, dazu
gab es wahrlich geeignetere Provinzen. Der häufige Regen in
Germanien wird Oliven nicht gefallen haben. Während zu den
Moselweinbergen der Römerzeit zahlreiche
verwaltungstechnische, literarische und archäologische
Belege existieren, sind bislang keine Dokumente zu einem
Olivenanbau bekannt. Allerdings waren Olivenhaine im
römischen Reich nicht genehmigungspflichtig wie Weinberge -
und völlig ausgeschlossen ist eine bescheidene
Olivenölproduktion z.B. an der Mosel nicht.
Dass der Römerzeit eine lange Kälteperiode folgte, ist
bekannt. Häufig wird sie gar für den Beginn vom Ende des
römischen Weltreiches gehalten - als Auslöser einer
Völkerwanderung und Ursache von Ernährungsproblemen im
Reich. Gegen Ende des ersten nachchristlichen Jahrtausends
begann dann wieder ein Klimaoptimum, das des Mittelalters.
Es ist durchaus denkbar, dass dann im Bereich des ehemaligen
Germaniens einige Olivenbäume der Römer, die das Pessimum
der Völkerwanderungszeit in besonders geschützten Lagen
überstanden hatten, weiter kultiviert wurden. Die guten
Beziehungen der Frankenkönige zu Rom sind bekannt -
zumindest sie und ihr Hofstaat dürften Olivenbäume nicht für
Unholz gehalten haben, das auszuroden ist. Andererseits ist
einzubeziehen, dass auch in Italien der Olivenanbau mit dem
Niedergang des römischen Reiches (und den damit zeitgleichen
klimatischen Veränderungen) erheblich zurückging, im Norden
fast vollständig. Es waren vor allem Klöster, zumal
benediktinische, die im nördlichen Mittelmeerraum das Wissen
um den Olivenanbau bis zu seiner breiten Wiederbelebung im
11. Jahrhundert bewahrten.
Es gibt gute Argumente dafür, dass im Hochmittelalter dann
einzelne Klöster in unserer Region auf der Basis ihrer
sozialen und kulturellen Beziehungen zum Mittelmeerraum auch
auf den Gedanken kamen, junge Olivenbäume für Neupflanzungen
über die Alpen zu bringen. So empfiehlt Hildegard von Bingen
im 12. Jahrhundert Tee/Sud aus Olivenrinde und
Olivenblättern als Heilmittel bei Gicht und
Verdauungsproblemen (Physica 3.16). Dies legt die Vermutung
nahe, dass sie diesen Baum auch unmittelbar in ihrem Kloster
zur Verfügung hatte - wenngleich sie, zurückhaltender, auch
die Dattelpalme aufführt, die selbst während des
Klimaoptimums sicherlich nicht im Mittelrheingebiet gedieh.
Interessanterweise wird Hildegard in einem Brief des
Zisterziensermönches Heinrich aus Maulbronn als "prächtiger
Olivenbaum" angesprochen. Dieses keineswegs häufige Bild für
Christus oder herausragende Persönlichkeiten im Christentum
(mit Bezug auf Römer 11,16-26) ist ein weiterer Hinweis auf
eine besondere und möglicherweise auch konkrete Beziehung
der Äbtissin zu diesem Baum. Hildegardis gehörte zudem dem
Orden der Benediktiner an, die sich der Wiederbelebung des
Olivenanbaus in Norditalien und im Burgund (das damalige
Burgund reichte bis zum Mittelmeer) besonders verschrieben
hatten. Ihre Klostergründung auf dem Rupertsberg bei Bingen
lag zudem in einer klimatisch begünstigten Region
Deutschlands - und die Zeit der Klostergründung, 1152, fiel
in den Kernbereich des mittelalterlichen Klimaoptimums, das
bald nach 800 begann und in der zweiten Hälfte des 13.
Jahrhunderts n. Chr. ausklang.
Die "kleine Eiszeit" vom 15. bis zum 19. Jahrhundert konnten
dann eventuell vorhandene Olivenbäume nördlich der Alpen
nicht überleben. Erst im 19. Jahrhundert stiegen die
Durchschnittstemperaturen in Mitteleuropa wieder signifikant
und kontinuierlich an, mit einem Vorlauf ab der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts. Eine Serie warmer Winter in den
30er Jahren des 20. Jahrhunderts (spekuliert werden kann
auch über einen Einfluß der Hitler-Mussolini-Beziehung)
brachte dann einen bislang von mir nicht identifizierten
Weinbauern bei Neustadt an der Weinstraße dazu, einen
Olivenhain in Deutschland anzupflanzen. Der erfror jedoch in
den harten Wintern ab 1939.
Die Klimaerwärmungsdebatte verführte Anfang des 21.
Jahrhunderts einige Olivenenthusiasten dazu, erneut
Olivenhaine in Deutschland anzulegen. Den ersten (und
vorläufig nördlichsten) davon haben 2005 die
Baumschulinhaber Heinz und Michael Becker sowie der
Olivenölhändler Stephan Marzak auf dem Gelände der
Baumschule Becker in Pulheim-Stommeln bei Köln begründet.
Die Bäume stammten teilweise aus der Olivenbaumsammlung
Marzaks, der bereits Anfang der 90er Jahre über sein
Unternehmen sortenechte Olivenbäume in Deutschland verkaufte
- also nicht die üblichen Oliven aus dem Gartencenter mit
der unspezifischen Bezeichnung "Olea europea".
2006 und 2007 fanden auf dem Gelände der Baumschule
"Olivenblütenfeste" statt und Anfang 2008 konnte schon die
erste Ernte von 25 Kilogramm vermarktet werden. Der Bestand
umfasste 2007/08 ca. 110 Bäume auf 1000 qm - wobei 45 Bäume
neu gepflanzt waren, also noch nicht nennenswert fruchten
konnten. Im Frühjahr 2008 verabschiedete sich Stephan Marzak
aus dem Projekt, um ein eigenes zu begründen, und die Brüder
Becker betrieben mit einem Teil des Bestandes und
Neupflanzungen den Hain alleine weiter. Der nachfolgende
Winter 2008/2009 hat dann dem Hain sehr zugesetzt. Obgleich
etwa dreißig Bäume der Toskana-Sorten Leccino und Olivastra
Seggianese noch Vitalität zeigten, haben die Beckers
beschlossen, am 8. Mai 2009 einen radikalen Neuanfang zu
starten - ausschließlich mit Jungbäumen dieser Sorten. Dafür
gibt es gute Gründe. Nach dem Extremwinter 1984/85 zeigte
sich in der Toskana, dass Neupflanzungen innerhalb weniger
Jahre frostgeschädigte Altanlagen im Ertrag überholen
können. Der frostige Winter 2009/10 machte dann in Köln
nochmals einen Neuanfang notwendig, wobei auch ältere Bäume
nachgepflanzt wurden.
Aus diesem ersten Olivenhain nördlich der Alpen hatte sich
Anfang 2008 der dann in gewissem Sinne älteste Olivenhain
Deutschlands abgespalten, nachdem es zwischen den Brüdern
Becker und Stephan Marzak zu Meinungsverschiedenheiten
gekommen war. Stephan Marzak von "Olive e Più" übersiedelte
einen Teil des von ihm eingebrachten Bestandes auf das
Gelände der Baumschule "La Cava" in Köln-Widdersdorf -
darunter die ältesten in Deutschland aus eingeführtem
Pflanzgut groß gewordenen Olivenbäume. Der Hain steht auf
einem Gelände von etwa 2000 qm und zählte 2008 etwa 180
Bäume. Auch in Köln-Widdersdorf hat der Winter 2008/09 keine
Schonung walten lassen. Die erfrorenen Jungbäume wurden
ersetzt durch Leccino und Canino/Canina (eine als robust
geltende Sorte aus dem nördlichen Latium in Mittelitalien),
ältere Bäume wurden zurückgeschnitten in der Hoffnung, dass
sie neu austreiben. Neuaustriebe sind im folgenden Winter
2009/10 zusammen mit den nachgepflanzten Jungbäumen wiederum
weitgehend erfroren.
Zeitgleich zur Teilung des Kölner Olivenhains habe ich
selbst Anfang 2008 meinen kleinen experimentellen Olivenhain
in Obergrombach/Kraichgau angelegt. Auf 1600 Quadratmeter
ehemaliger Weinbergsfläche pflanzte ich zunächst 26 Heister
der Sorten "Leccino", "Maurino" und "Olivastra Seggianese" -
alle drei vor allem in der Toskana heimisch. Weitere Bäume
unterschiedlicher Sorten und Herkünfte kamen 2009 und 2010
dazu. In den strengen Wintern 2008/09 und 2009/10 habe ich
umfangreiche Schutzmaßnahmen mit Einhüllungen durchgeführt.
Dennoch wurden zahlreiche Individuen stark geschädigt. Von
den Pflanzungen der "ersten Generation" waren im Mai 2010
nur noch zwei Olivastra Seggianese (von acht) und vier
Leccino (von vierzehn) in akzeptablem bis gutem Zustand
erhalten. Dazu hat in ausgezeichnetem Zustand ein 2009
gepflanztes Exemplar "Ascolana" (von zweien) den Winter
überstanden - eine Öl- und Speiseolive aus der
mittelitalienischen Region Marche. Gänzlich abgestorben sind
lediglich sechs von 34 Heistern/Jungbäumen.
An der Mosel hat ein deutsch-türkisches Ehepaar aus Köln
unter großer Medienbegleitung im Frühjahr 2009 einen
Olivenhain mit 200 Bäumen türkischer Herkunft (Sorte
Memecik) auf 4000 Quadratmetern angelegt, bei Pünderich. Der
Hain liegt in einem Weinberggelände direkt am Fluss, mit
einem Boden, der "reich ist an Schiefergebröckel", wie ein
römischer Autor im 6. Jahrhundert schrieb. Die Betreiber der
Anlage sind nebenberuflich im Olivenölhandel tätig und
besitzen bereits seit einigen Jahren einen Olivenhain mit
400 Bäumen in der Türkei/Sirinçe. Als Winterschutz wurden an
der Mosel Stroheinhüllungen eingesetzt. Nach dem Winter
2009/10 sind oberirdisch allerdings keine vitalen
Pflanzenteile verblieben. Die Prognosen für einen
Mosel-Olivenhain sind angesichts der
temperaturausgleichenden Wirkung des Flusses und der
wärmespeichernden Eigenschaften des "Schiefergebröckels"
grundsätzlich sehr günstig.
Gleichfalls Anfang 2009 wurde in Gangelt bei Aachen, einem
Ort mit zahlreichen Hitzerekorden, eine Anlage aus 140
importierten alten Bäumen aus Portugal gestaltet. Auch diese
Anlage litt im Winter 2009/10.
Da verschiedene Klimamodelle auch für die kommenden Jahre
(Stand 2010) eher strenge Winter in Mitteleuropa
prognostizieren, wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis
realistische Chancen auf die Etablierung eines bescheidenen
Olivenanbaus in Deutschland bestehen. Die mit dem aktuellen
Klimawandel verbundenen ansteigenden Niederschläge im
Winterhalbjahr könnten zu bislang noch vernachlässigten
zusätzlichen Problemen für hiesige Olivenbestände führen,
etwa durch Pilzerkrankungen wie Occhio di Pavone und
Piombatura.
*
Wie es weiterging mit dem Olivenanbau in Deutschland
nach 2010 und Ergebnisse weiterer historischer Recherchen
von Hartmut Schönherr - 28. Juni 2025
Das Projekt mit eingeführten älteren Bäumen in
Gangelt-Kreuzrath bei Aachen wurde nach zwei harten Wintern
beendet und die Bäume im Rahmen einer "Skulpurenwoche" 2011
von 10 europäischen Bildhauern in Kunstwerke transformiert.
Der Hain des deutsch-türkischen Ehepaares Aktül-Schäfer an
der Mosel und der Hain des Olivenölhändlers Stephan Marzak
in Köln-Widdersdorf wurden nach wiederholten Frostschäden
2012 aufgegeben. Mein eigener Olivenhain hat im extremen
Frostfebruar 2012 mit zwölf aufeinander folgenden
Frostnächte bei zweistelligen Minustemperaturen zwischen
01.02.12 und 13.02.12 die letzten noch erhalten gebliebenen
Stämme weitgehend verloren. Es blieben nur zwei Olivastra
Seggianese und zwei Leccinos als Veredelung erhalten, der
Rest starb ab oder trieb aus der Unterlage als Wildform aus.
In der Folge pflanzte ich weitere Heister. Stand 2025 habe
ich 40 Pflanzen von 13 Sorten aus 4 verschiedenen Ländern,
dazu eine Wildolive. Von den weiteren Versuchen blieb noch
der Hain der Gebrüder Becker, in ihrem Gartenbaubetrieb bei
Pulheim-Stommeln, erhalten, mit wiederholten Neupflanzungen.
In Deutschland war der Olivenenthusiasmus nach dem
Frostfebruar 2012 zunächst einmal nachhaltig gedämpft. Ab
2016 kam es in Österreich zu einer Welle an Olivenanlagen,
überwiegend durch Winzer, im Burgenland und in
Niederösterreich. Aus Deutschland ist für 2020 ein
Verpflanzungsprojekt analog dem Versuch in Gangelt von 2009
zu vermelden, mit 80 älteren Bäumen aus Südspanien.
Gepflanzt wurde von einem ehemaligen Schönheitschirurgen und
Hobbywinzer in den besonders privilegierten Weinbergen bei
Ihringen am Kaiserstuhl. Vorläufig kann der Hain von relativ
milden Wintern profitieren. Weitere kleine Versuche mit
Jungpflanzen wurden nach 2012 vor allem von Winzern im
Kontext ihres Weinbaus realisiert. 2025 geisterte die
Behauptung "Erste Winzer stellen um auf Olivenanbau" durch
die Medien. Hinter der Behauptung steht eine Pflanzung von
30 Olivenheistern auf einem Gelände von 2.400 Quadratmetern
in Weinsberg bei Heilbronn durch einen Winzer im Ruhestand.
Bei weiteren historischen Recherchen zum Thema habe ich
erneut interessante Dokumente gefunden, die auf die
Möglichkeiten (oder Unmöglichkeiten) eines Olivenanbaus in
Deutschland eingehen. "Weil bei der übermäßigen Kälte die
Beschaffenheit der Luft so ungünstig ist, so wächst daselbst
(in "Gallien" - H.Sch.) weder Wein noch Öl." - das schreibt
Diodor (1. Hälfte erstes vorchristliches Jahrhundert)
in Buch V seiner Universalgeschichte, Kapitel 26 ("Über
Klima und Trunksucht bei den Galliern", Übersetzung von
Julius Friedrich Wurm 1831). Und bei Tacitus heißt es um das
Jahr 100 nach Christus über "Britannien": "Solum praeter
oleam vitemque et cetera calidioribus terris oriri sueta
patiens frugum pecudumque fecundum: tarde mitescunt, cito
proveniunt; eademque utriusque rei causa, multus umor
terrarum caelique." ("Abgesehen von Oliven und Weintrauben
und anderen Früchten wärmerer Regionen ist die Erde
brauchbar für Landwirtschaft und Viehzucht: Die Ernten
reifen langsam, aber ergiebig. Der Grund für beides ist
reichlich Feuchtigkeit in der Erde und in der Luft.") - "De
vita et moribus Iulii Agricolae", Kapitel 12,5. Frost sei
indes in Britannien kein Problem, schrieb Tacitus auch. Im
3. nachristlichen Jahrhundert führten die Römer dann im Zuge
des römerzeitlichen Klimaoptimums den Weinbau in Britannien
ein. Innerhalb eines Zeitraums von drei Jahrhunderten hatten
sich offensichtlich die Klimabedingungen erheblich
verändert!
"Une production d'huile en Belgique et en Germanie?", fragt
der französische Archäologe Jean-Pierre Brun vorsichtig in
seinem dem Wein- und Olivenanbau in "Gallien" gewidmeten
Werk "Archéologie du vin et de l'huile en Gaule romaine"
2005. Er stützt sich dabei auf Funde von lokal produzierten
Ölamphoren. Brun vertieft das Thema dann nicht in Richtung
Olivenöl, sondern begnügt sich mit einem Hinweis auf Nussöl.
Zu dünn sei die Faktenlage vorläufig noch, differenzierte
chromatographische Untersuchungen der gefundenen Ölamphoren
auf breiter Basis seien noch durchzuführen, so der Autor.
Bei einer Reise in die Eifel entdeckte ich im August 2014
das "Kalendergedicht" des Wandalbert von Prüm (vermutete
Lebenszeit 813-870). Er empfiehlt darin für eben den Monat
August: "Setzt zu den schmackhaften Weinen die liebliche
Feige und Pflaume". Der Kontext mit Erntebildern ("pflückt
man vom Baum das reif gewordene Obst") legt es nahe, dass
Feigen auch in seinem unmittelbaren Erfahrungsbereich im
Kloster Prüm bzw. in den zugehörigen Weinbergen an Ahr,
Mosel und Rhein gediehen. Natürlich ist einzubeziehen, dass
sein Kalendergedicht auch antike Vorbilder hatte. Er
publizierte in klösterlich-gelehrter Bildungstradition, was
bedeutet, das literarische Quellen den gleichen Stellenwert
hatten wie eigene Erfahrungen. Dies gilt auch für die
bildlichen Darstellungen. Im Textteil finden sich jedoch
deutliche Hinweise auf die eigene Lebenswelt Wandalberts. So
schreibt er etwa von der "Jagdlust" der Franken und von der
Schweinemast im herbstlich-frühwinterlichen Wald, von Frost
und Schnee im Winter - was er gewiss nicht von lateinischen
Vorlagen übernommen hatte. Eine weitere Bestätigung dafür,
dass das anhebende mittelalterliche Klimaoptimum im
Bodensee-Oberrhein-Mittelrhein-Bereich sich auch im
Kulturpflanzenspektrum widerspiegelte, findet sich etwa
zeitgleich bei Walahfrid Strabo (808/09-849), Abt auf der
Reichenau, in dessen Schrift "De cultura hortorum". Er nennt
in seiner musterbildenden Schrift Wermut, Fenchel und
Melone.
Auch andere Zeugnisse lassen vermuten, dass im Mittelalter
Olivenbäume an Rhein und Mosel gestanden haben könnten. In
den "Annales Colonienses maximi" findet sich zum Winter
1232/33: "Eodem anno hyems solito asperior inhorruit et
multas vineas, ficus et olivas per Italiam, Franciam et
Teutoniam congelavit." Sind zu "Teutoniam" nur "vineas"
gemeint oder auch "ficus et olivas"? Und in der
Korrespondenz zwischen Martin Luther und seiner Anhängerin
Elisabeth von Calenberg ist zu lesen, dass Luther in den
Jahren um 1540 Maulbeer- und Feigenpflanzen von Wittenberg
nach Münden (heute Hann. Münden), ins Schloss schickte. In
Münden gibt es in einem Neubaugebiet, allerdings weit
entfernt vom Schloss, einen solitären "Maulbeerweg", der an
die Bäume Luthers erinnert, die noch bis in die 1920er Jahre
in Münden standen. Allzu eng dürfen wir also die "kleine
Eiszeit", deren Beginn auf die Jahre um 1250 angesetzt wird,
nicht verstehen. Es gab offensichtlich geographisch und
zeitlich ein erhebliches Differenzspektrum. Der Sommer 1540
("Jahrtausendsommer") wird als außergewöhnlich heiß und der
nachfolgende Winter als äußerst mild (Badewetter an
Weihnachten) in Deutschland geschildert. In Würzburg haben
die Hofkellermeister einen Wein produziert, der über
Jahrhunderte hinweg zum Mythos wurde.
Der Archäobotaniker Hans-Heinz Knörzer hat das "Auftreten
thermophiler Pflanzen im Niederrheingebiet" untersucht und
dabei einen extrem hohen Anteil an Thermophyten während der
Römerzeit festgestellt (98,1% bei den Ruderalen, 100% bei
den Ackerbegleitkräutern). In der Römerzeit sind 35
ausschließlich thermophyle Ackerbegleitkräuter aus dem
Mittelmeergebiet in die Rheinebene eingewandert. Knörzers
jüngerer Kollege Hansjörg Küster untersuchte Pflanzenspuren
in Konstanz am Bodensee, die aus dem 13. bis 15. Jahrhundert
stammten. Dabei stieß seine Arbeitsgruppe auf Spuren von
Feigen (Ficus carica) und Granatapfel (Punica granatum).
Küster führt diese Funde auf Importe zurück, da es keine
Parallelbelege aus dörflichen Siedlungsbereichen gebe. Was
allerdings auch darauf zurückzuführen sein könnte, dass erst
im 15. Jahrhundert die anspruchsvolle Gartenkultur den
Bereich der Klöster verließ.
Literatur:
Brun,
Jean-Pierre: Archéologie du vin et de l'huile en Gaule
romaine, 2005
Glaser, Rüdiger: Klimageschichte Mitteleuropas, 2001
Hildegard von Bingen: Physica, Augsburg: Pattloch, 1997
Hildegard von Bingen: Im Feuer der Taube. Die Briefe, 1997
Knörzer, Karl-Heinz: Das Auftreten thermophiler Pflanzen
im Niederrheingebiet während des Postglazials, 1989
Küster, Hansjörg: Mittelalterliche Pflanzenreste aus
Konstanz am Bodensee, 1989
Walahfrid Strabo: De cultura hortorum/Über den Gartenbau,
Reclam 2002
Wandalbert von Prüm: Das Kalendergedicht, Auxilium-Verlag
1992
|