SEITENINHALT:
Kulturgeschichte des Olivenanbaus: Kupferzeit in der Levante - Ägyptische Pharaonenzeit - Phönizier - Kelten, Etrusker und Illyrer - Griechische Antike - Römische Antike - Mittelalter - Conquista
Olivenkulturen einzelner Länder und Regionen: Albanien - Argentinien - China - Frankreich - Griechenland - Iran - Italien - Spanien - Südafrika - Syrien - Toskana - USA. Weitere Länder und Regionen (neue Seite).
Geschichten und Anekdoten zur Olive: Athens Gründungsmythos - Derwischtum - Benediktinertum - Hildegard von Bingen - Französische Revolution - Kolonie "Olivenhain" Kalifornien - DDR - Die weißen Oliven von Malta - Die kriechenden Oliven von Pantelleria - Die sprechende Olive von Seggiano - Oliven als invasive Neophyten
Oliven in der Bildenden Kunst und in der Literatur: Homers "Odyssee" - Renaissancemalerei - Du Bellays "L'Olive" - Van Gogh
Skandale und Politika: Giftölskandal - Schmutziges Gold - EU-Misswirtschaft - Olivenöl-Mafia - Sensorik-Hype und Bio-Skepsis - Konkurrenz Spanien-Italien - Palästina-Konflikt - Kurden-Konflikt
Inspirierende Olivenprojekte: Olivenöl-Kampagne - Himalaya Regionalentwicklung - Namibia "Steps for Children" - Mecklenburg-Vorpommern - Schülerprojekt
Olivenpflanzungen in Deutschland/nördlich der Alpen/Österreich: Antike - Mittelalter - Pfalz - Pulheim-Stommeln - Köln-Widdersdorf - Gangelt-Kreutzrath - Mosel - Kaiserstuhl - Ahrweiler - Stone in Oxney - Österreich
Meine Explorationsreisen: Naxos 2008 - Azienda Sperimentale 2009 - Pistoia 2010 - Provence 2012 - Nyons 2017 - Seggiano 2018 - Albanien 2018 - Mittelitalien 2025
Kulturgeschichte des Olivenanbaus: Kupferzeit in der Levante - Ägyptische Pharaonenzeit - Phönizier - Kelten, Etrusker und Illyrer - Griechische Antike - Römische Antike - Mittelalter - Conquista
Olivenkulturen einzelner Länder und Regionen: Albanien - Argentinien - China - Frankreich - Griechenland - Iran - Italien - Spanien - Südafrika - Syrien - Toskana - USA. Weitere Länder und Regionen (neue Seite).
Geschichten und Anekdoten zur Olive: Athens Gründungsmythos - Derwischtum - Benediktinertum - Hildegard von Bingen - Französische Revolution - Kolonie "Olivenhain" Kalifornien - DDR - Die weißen Oliven von Malta - Die kriechenden Oliven von Pantelleria - Die sprechende Olive von Seggiano - Oliven als invasive Neophyten
Oliven in der Bildenden Kunst und in der Literatur: Homers "Odyssee" - Renaissancemalerei - Du Bellays "L'Olive" - Van Gogh
Skandale und Politika: Giftölskandal - Schmutziges Gold - EU-Misswirtschaft - Olivenöl-Mafia - Sensorik-Hype und Bio-Skepsis - Konkurrenz Spanien-Italien - Palästina-Konflikt - Kurden-Konflikt
Inspirierende Olivenprojekte: Olivenöl-Kampagne - Himalaya Regionalentwicklung - Namibia "Steps for Children" - Mecklenburg-Vorpommern - Schülerprojekt
Olivenpflanzungen in Deutschland/nördlich der Alpen/Österreich: Antike - Mittelalter - Pfalz - Pulheim-Stommeln - Köln-Widdersdorf - Gangelt-Kreutzrath - Mosel - Kaiserstuhl - Ahrweiler - Stone in Oxney - Österreich
Meine Explorationsreisen: Naxos 2008 - Azienda Sperimentale 2009 - Pistoia 2010 - Provence 2012 - Nyons 2017 - Seggiano 2018 - Albanien 2018 - Mittelitalien 2025
Die Region gilt als eine der ältesten Olivenanbauregionen der Welt, die älteste im Mittelmeerraum. Archäologische Funde im heutigen Jordanien, el-Khawarij, datieren aus dem 5. vorchristlichen Jahrtausend. In Israel wurde bei einer Notgrabung vor Straßenbau in En Zippori 2012 (unter zahlreichen anderen Artefakten) ein Tonkrug aus dem 6. Jahrtausend v. Chr. mit Olivenölspuren gefunden. Mit der Kultur von Ebla im heutigen Nordwestsyrien ist der Olivenanbau in der zweiten Hälfte des dritten vorchristlichen Jahrtausends in der Region fest etabliert. Die Phönizier brachten von der Levante aus den Olivenbaum ins nördliche Afrika, nach Griechenland, nach Sizilien und Spanien. Wobei dies wohl in verschiedenen Bewegungen, zunächst über Handel, dann über Koloniengründungen, verlief.
Im Kulturraum der Levante führt Olivenöl ein in die Welt des Numinosen, als Salbung. Diese Bedeutung ist bis in die Gegenwart im Christentum erhalten geblieben (Krankensalbung, "Letzte Ölung"). Von großer Bedeutung ist auch Olivenöl als Lichtbringer in Öllampen und Leuchtern. Im jüdischen Kultus darf nur geweihtes Olivenöl für die Flammen der Menorah, des siebenarmigen Leuchters, verwendet werden.
Das erste - nicht eindeutige - Zeugnis zu einem ägyptischen Olivenanbau stammt aus der Spätzeit der 12. Dynastie, aus dem 19. Jahrhundert v. Chr., belegt im "Thesaurus Linguae Aegyptiae". In einem Brief aus Illahun wird zur Abrechnung aufgelistet, was zum Fleischopfer des Stieres im Totentempel von Sesostris II. notwendig war, u.a. Oliven. Ein bedeutsames Bilddokument zur besonderen Wertschätzung der Olive stammt aus der Regierungszeit Echnatons, der auf einem Relief seinem bevorzugten Gott Re-Aton einen Olivenzweig reicht (oder diesen von Aton bekommt?). Im Grab seines Sohnes Tutanchamun findet sich dann ein mit Olivenblattornament verzierter Silberbecher. Olivenzweige und/oder Olivenblätter fanden sich nach Lucas/Harris ("Ancient Egyptian Materials and Industries", 1934) in verschiedenen Gräbern seit der 18. Dynastie.
Die von Erik Hornung ("Der Eine und die Vielen", 1971) herausgearbeitete "Verkürzung auf den solaren Aspekt" (S. 242) in der Götterwelt Echnatons lässt sich verbinden mit dem 200 Jahre jüngeren Olivenpreis in der Widmung an den Sonnengott Ra/Re von Ramses III. (Großer Papyrus Harris/Harris I, Tafel 27 - Übersetzung August Eisenlohr 1873):
Ich machte dir Lanstrecken von Olivenbäumen in deiner Stadt An. Ich versah sie mit Gärtnern, zahlreichen Leuten um reines, bestes Öl von Ägypten zu bereiten, um anzuzünden die Lampe in deinem prächtigen Tempel.
Ramses III. hatte für den Ra-Tempel in An/Heliopolis 2.750 Hektar Olivenhain anlegen lassen. Was er in seiner Widmung dabei ausdrücklich nennt, ist die Bedeutung von Olivenöl als Leuchtmittel. Die Verbindung Sonne-Olivenbaum ist hier augenscheinlich. Auch wenn Echnatons religiös-weltanschauliche Reform nach seinem Tod von der Amun-Priesterschaft wieder weitgehend aufgehoben wurde, hat sich seine bereits von den Vorgängern eingeleitete Licht-/Sonnenverehrung halten können, bis die Theokratie der Amunpriester in Theben die 3. Zwischenzeit einläutete. Dies lässt sich auch aus der symbolisch aufgeladenen Wertschätzung des Olivenbaums ableiten.
Hauptsiedlungsgebiet der semitischen Phönizier war ursprünglich die Levante, waren das heutige Küstengebiet Syriens, des Libanon und des nördlichen Israel. Hier gründeten sie in der Zeit um 1000 v. Chr. mehrere Stadtstaaten, die lose miteinander verbunden waren und insbesondere zum gemeinsamen Handel im Mittelmeer organisatorische Bündnisse schlossen. (Quelle Abbildung: Wikipedia, gemeinfrei)
Wie eine im Februar 2019 veröffentlichte Untersuchung von Tzilla Eshel u.a. aus Israel nahe legt, galt ein zentrales
 Handelsinteresse der Phönizier dem Silber.
Sie haben zunächst den Silberhandel mit Anatolien gepflegt
und dann ab etwa 900 v. Chr. in Südspanien und auf Sardinien
(v.a. Iglesiente im Südwesten) die Silbergewinnung
entwickelt und handelsmäßig erschlossen. Zur Stützung ihrer
Handelswege und der Silbergewinnung gründeten sie im
nördlichen Afrika, im Süden der iberischen Halbinsel und auf
Sardinien mehrere Siedlungen, von denen die bekannteste
Karthago wurde.
Handelsinteresse der Phönizier dem Silber.
Sie haben zunächst den Silberhandel mit Anatolien gepflegt
und dann ab etwa 900 v. Chr. in Südspanien und auf Sardinien
(v.a. Iglesiente im Südwesten) die Silbergewinnung
entwickelt und handelsmäßig erschlossen. Zur Stützung ihrer
Handelswege und der Silbergewinnung gründeten sie im
nördlichen Afrika, im Süden der iberischen Halbinsel und auf
Sardinien mehrere Siedlungen, von denen die bekannteste
Karthago wurde.Die Phönizier führten auf ihren Schiffen auch zahlreich Olivenpflanzen mit sich, nicht nur als Handelsware, sondern - zunächst vermutlich vorrangig - zur Pflanzung in ihren Siedlungen. Sie begründeten so die Olivenkulturen in Libyen (ausgehend von Leptis u.a.) und Tunesien (ausgehen von Utica - laut Velleius Paterculus bereits um 1100 v. Chr. gegündet - und Karthago). Darüber hinaus trugen sie zur Verbreitung des levantinischen Olivengenoms im gesamten Mittelmeerraum bei. Was die Begründung der Olivenkultur in Griechenland, Sizilien, Sardinien, Spanien und Marokko betrifft, lassen sich bislang noch keine verbindlichen Aussagen über eventuell von der Levante unabhängige Olivendomestikationen im Mittelmeerraum und ggf. deren Ausbreitung machen.
Zu den Etruskern kam der Olivenanbau vermutlich durch die Phönizier. Allerdings dürften später auch Pflanzen über die griechischen Kolonien in Süditalien den Weg in das etruskische Einflussgebiet gefunden haben. Im etruskischen Kernland Italiens findet sich eine der ältesten und stabilsten Olivensorten Italiens, Olivastra Seggianese bei Seggiano. Der Archäobotaniker Claudio Milanesi, der Historiker Andrea Ciacci und andere haben in einem interdisziplinären Projekt (ELEIA) die Entwicklung des Olivenanbaus bei den Etruskern untersucht - wobei sie sich auf die Region um den Monte Amiata und das Val d'Orcia konzentrierten. Über Jahrhunderte waren die Etrusker offensichtlich abhängig von griechischen Olivenöl-Importen. Im 7. vorchristlichen Jahrhundert kam es jedoch zur breiten Etablierung eines etruskischen Olivenanbaus. Die Varietät Olivastra Seggianese könnte davon noch ein botanisch-agronomisches Zeugnis sein. Von Interesse zum etruskischen Olivenanbau ist auch die Region um Canino in der Maremma, mit der gleichnamigen robusten Varietät.
Lange galt im allgemeinen Bewußtsein Griechenland, insbesondere Kreta, als Heimat der Olivenbaum-Domestikation - obgleich der Kulturwissenschaftler Victor Hehn bereits 1870 daran seine Zweifel anmeldete. Dann geriet die Levante mit spektakulären archäologischen Funden in den Fokus. Inzwischen geht man, insbesondere in der französischen Forschung, von mehreren voneinander unabhängigen Domestikationszentren aus. Dabei werden in der albanischen Forschung auch die Illyrer genannt als Kandidaten für die erste Domestikation der Olive. Als Hinweise darauf gelten insbesondere Ölbäume in der Umgebung von Tirana, deren Alter auf weit über 3000 Jahre geschätzt wird. Die albanische Volkskultur ist voller Bezüge zur Olive - allerdings fehlt es an einer überzeugenden Herleitung dieser Bezüge aus illyrischer Zeit.
Der Weg aus dem vermuteten ersten Domestikationszentrum in Kleinasien nach Griechenland verlief über phönizische Handelsketten - wobei vermutlich die kretisch-minoische Kultur (die Hehn noch nicht kannte, Evans reiste erst 1894 nach Kreta) wichtiges Bindeglied war. Einige der ältesten bekannten Olivenbäume weltweit stehen auf Kreta. Berühmt ist vor allem die noch auffallend holzreiche Olive von Ano/Pano Vouves, deren Alter auf 3.500 bis 5.000 Jahre geschätzt wird. Die Problematiken der Dendrochronologie wie der Radiokarbonmethode für die Altersbestimmung von Oliven sind bekannt. Aus dem ersten Lebensjahrtausend einer auch "nur" 2.000 Jahre alten Olive sind keine Holzstruktur, geschweige Jahresringe erhalten. Aus dem Umfang einer Olive (mit im Alter zunehmend hohlem Innenraum) kann jedoch das Alter des Wurzelstocks grob abgeschätzt werden. Präzisere Auskünfte gibt unter günstigen Umständen eine aufwendige Radiocarbonanalyse (AMS) des Sediments im Innenraum.
In der griechischen Antike umfasste das Bedeutungs- und Verwendungsspektrum der Olive die Ernährung (als Frucht und Öl), die Heilkunde (Öl und Blätter), das Hauswesen (als Lichtspender in Öllampen), die Körperpflege (als Hautöl), den Sport (Öleinreibungen etwa beim Ringen, Olivenzweig als Auszeichnung) und im Kultus (Öl als Lichtspender, als Altaropfer, zur Weihe, zur Balsamierung von Toten; Zweige als Symbole für Ewigkeit, Fruchtbarkeit u.a.). Das Harz des Olivenbaums wurde als Weihrauch verwendet. Auch in der Möbel- und Bodenpflege wurde offensichtlich Olivenöl eingesetzt.
Im etablierten römischen Reich wurde der Olivenbaum verbreitet, wo immer er gedeihen konnte. Allerdings sorgte das ausgeklügelte Transport- und Handelssystem dafür, dass tunesisches und spanisches Olivenöl reicher Großgrundbesitzer keine ernsthafte Konkurrenz durch lokalen Anbau bekam. Die Olivenölabfüller in Italien knüpfen aktuell an diese Tradition des römischen Reiches an: Bei einer Untersuchung 2011 stammten 80% des "italienischen" Olivenöls der Kategorie "Extra Vergine" aus Tunesien, Spanien und Griechenland.
Es ist anzunehmen, dass selbst in den Rheinprovinzen zumindest einige solitäre Olivenbäume gepflanzt wurden, vielleicht auch ganze Haine. Allerdings war die Anlage von Olivenhainen im Römischen Reich nicht meldepflichtig wie die Anlage von Weinbergen, weshalb die Quellenlage wenig aussagekräftig ist.
Genutzt wurde das Olivenöl im römischen Reich zu Speisezwecken, für Lampen, als Heilmittel, im Kultus und in der Körperpflege (Massage). Die symbolische Wertigkeit des Olivenbaumes wird etwa daran deutlich, dass die Göttin Minerva, Schutzgöttin Roms und vermutlich etruskischen Ursprungs, ab dem 3. vorchristlichen Jahrhundert Schutzgöttin des Olivenbaums wurde - schriftlich belegt ist dies allerdings erstmals durch Marcus Terentius Varro im 1. vorchristlichen Jahrhundert.
Genaue Daten über den Olivenanbau im Mittelalter liegen kaum vor, da die Erforschung der materiellen Kultur des Mittelalters stark zersplittert ist und sich weniger auf Landwirtschaft und Kulturpflanzengebrauch, mehr auf Essen und Marktangebote richtet. Zum Gartenbau gibt es aus dem klösterlichen Kontext Angaben, die auf die Verbreitung wärmeliebender Pflanzen auch nördlich der Alpen verweisen - etwa bei Wandalbert von Prüm und Walahfrid Strabo. Allerdings stehen diese Autoren in innerliterarischen Traditionslinien, die es oft unmöglich machen, zu entscheiden, wo sie auf eigene Erfahrungen vor Ort, wo auf Literaturvorbilder zurückgreifen.
Im 10. und 11. Jahrhundert kam es mit der Klimaerwärmung zu einer Renaissance des Olivenanbaus in nördlichen Mittelmeerregionen, die wesentlich von Benediktinern vorangetrieben wurde, etwa ab 1050 in Ligurien durch die Mönche von Sestri Ponente/Genua, im Piemont durch die Mönche von San Dalmazzo da Pedona bei Cuneo. Im Gefolge dieser Renaissance ist vermutlich auch Hildegard von Bingen auf den Olivenbaum als Heilpflanze aufmerksam geworden. Vorläufig kann über eine Präsenz des Olivenbaums auch in ihren Klöstern am Rhein allerdings nur spekuliert werden. Der Bereich des Hildegardschen Klosters Rupertsberg steht durch die Anlage einer Bahntrasse für die Nahetal-Eisenbahn nicht mehr für Bodenuntersuchungen zur Verfügung. Kloster Eibingen (jetzt Pfarrkirche St. Hildegard) dürfte im Laufe seiner komplexen Baugeschichte gleichfalls relevante botanische Bodenzeugnisse - so es sie gab - verloren haben.
In Südfrankreich, Norditalien, an der dalmatinischen Küste und im nördlichen Griechenland konnte sich der Olivenanbau wieder langfristig etablieren, bis es mit der Kleinen Eiszeit ab 1300 erneut kühler wurde in der nördlichen Hemisphäre, was allerdings nicht zu einem vergleichbar dramatischen Einbruch führte wie in der frühmittelalterlichen Kälteperiode. Noch um 1540 schickte Martin Luther Maulbeer- und Feigenpflanzen von Wittenberg nach Münden, zu seiner Anhängerin Elisabeth von Calenberg.
1530 kamen einige Dominikaner und Franziskaner nach Peru, mit dem Conquistador Belalcázar. Darunter der Franziskaner Marcos de Niza (1495-1558), Augenzeuge der Zerstörung des Inka-Reiches. Olivenbäume brachten er und seine Gefährten offenkundig nicht mit. Erst der Konquistador Don Antonio de Ribera, verwandtschaftlich verbunden mit Pizzaro, Prokurator Perus, reich geworden durch Inka-Gold, machte sich 1560 mit etwa 100 Olivensetzlinge an Bord auf den Weg nach Peru. Allerdings überlebten nur drei die lange Reise. Eine der Pflanzen wurde dann auch noch gestohlen und einer Legende zufolge nach Chile verbracht, wo sie die Olivenhaine von Valparaiso hervorgebracht habe. Zu Tisch bei Don Ribera wurden die eigenen Oliven den Gästen vorgezählt, je nach Ernte 1-3 Exemplare. Nach Argentinien und Chile kamen Olivenpflanzen in dieser Zeit nur sekundär, ausgehend von Peru. 1637 pflanzte der in Peru geborene Dominikaner San Martín de Porres einer Überlieferung zufolge Oliven bei Lima, im heutigen Distrikt San Isidro.
Der Vizekönig von Peru 1667-1672, Pedro Fernández de Castro, ließ Olivenhaine in Peru, Chile und Argentinien zerstören, um den Olivenbauern Andalusiens keine Konkurrenz zu ziehen. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts kamen vor allem durch Franziskaner Oliven (erneut) nach Peru. Und möglicherweise liegt hier schon der Ursprung der Varietät "Mission", falls es richtig ist, dass die mexikanischen Oliven des Eusebio Francisco Kino von Peru kamen - woran es begründete Zweifel gibt, da die Pflanzungen mit geringem zeitlichen Abstand stattfanden.
Aus der Mitte des 18. Jahrhunderts ist ein Olivenhain im Distrikt San Isidro, etwa sechs Kilometer vom historischen Zentrum Limas entfernt, überliefert mit 2000 Olivenbäumen. Und im Jahr 1821, dem Jahr der Unabhängigkeitserklärung Perus, ist dieser Bestand auf 3.000 Olivenbäume angewachsen. 1959, inzwischen schon umwuchert von den Neubaugebieten Limas, wurde der Hain, als "Parque El Olivar", zum Nationaldenkmal erklärt. Dieser Bestand wird auf San Martín de Porres zurückgeführt. Andere sehen in ihm die Folge von Pflanzungen de Riberas. Eine wissenschaftliche Altersuntersuchung erbrachte für einen der Bäume ein Alter von ca. 374 Jahren. Ein Baum auf der Hacienda Glorieta Grande (Familie Tokunaga) im Süden Perus, Provinz Moquega, wird auf 368 Jahre geschätzt.
Der Olivenbaum wurde offensichtlich als ein wesentliches Symbol der spanisch-christlichen Kultur gezielt sowohl von den Missionaren als auch von den Grundherren und Siedlern auf den "Encomiendas", "Reducciónes" und "Haciendas" angebaut. Olivenöl diente im religiösen Ritus der Mission als Lichtquelle und zur Salbung - und es wurde von den Indios wegen seiner rußarmen Leuchtkraft in den spanischen Öllampen besonders verehrt.
Lektüreempfehlungen:
Johannes Meier (Hrsg.), Sendung- Eroberung - Begegnung. Franz Xaver, die Gesellschaft Jesu und die katholische Weltkirche im Zeitalter des Barock, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2005
Robert Ricard, La conquête spirituelle du Mexique, Paris 1933
Diese glückliche Situation bietet vorzügliche Grundlagen für Untersuchungen zu den genetischen Abstammungslinien europäischer Olivensorten. Eine bemerkenswerte Arbeit von Biljana Lazovic an der Universität Bar (Montenegro) hat bereits zwei stark differierende Abstammungslinien von Olivenbäumen der Region festgestellt, die bis in die Antike zurückreichen, vertreten durch die Sorten "Stara Maslina" und "Zutica". Vergleichbare Untersuchungen werden von Hairi Ismaili an der Landwirtschaftlichen Universität Tirana durchgeführt. Er forscht unter anderem zur Frage, welchen Beitrag der illyrische Kulturraum zur Olivendomestikation geleistet habe. Das Gebiet des heutigen Albanien war für die phönizischen Handelsflotten ein wichtiges Absprungbrett von der griechischen Küste nach Süditalien. Hier könnten sich schon früh Oliven levantinischen Ursprungs mit solchen, die aus der vermuteten Herkunftsregion der Illyrer aus dem Raum zwischen Schwarzem Meer und Kaspischem Meer stammten, überkreuzt haben. Die albanische Hauptsorte Kaninjot wird auch in Mazedonien angebaut, genetische Untersuchungen dort könnten künftig auch weitere Aufschlüsse zu den Ursprüngen der albanischen Olivenkultur geben.
Belul Gixhari, Hairi Ismaili und andere Mitarbeiter der Landwirtschaftsuniversität Tirana führen in ihrem Konferenzpapier "Olive in the story and art in Albania" von 2014 den Olivenanbau in Albanien auf phönizische Pflanzeneinfuhren zurück. Die ältesten albanischen Olivenbäume schätzen sie auf ca. 3.000 Jahre, der Anteil an über tausendjährigen Bäumen wird auf 10% (Stand 2013) veranschlagt. In "The origin of the olive in Albania" referieren Gixhari und Ismaili auch die These, dass die Illyrer es waren, die erstmals Oliven kultivierten. Ismaili veröffentlicht Anfang 2018 auf Researchgate ein Papier, das 28 Olivenbäume im Umland von Tirana identifiziert, deren Alter zwischen 1.250 und 3.800 Jahren angesetzt wird.
Olivenernte laut FAO 2016: 0,099 Mio Tonnen.
Die ersten Olivenpflanzungen in Argentinien fanden den Überlieferungen zufolge 1553 mit Material aus Peru statt, bei der Gründung der Stadt Santiago del Estero durch Francisco de Aguirre de Meneses (1508-1581), der zunächst mit ein paar Reitern und Fußvolk an der Eroberung Perus, dann Boliviens, dann Chiles teilgenommen hatte und als besonders brutal im Umgang mit der Indiobevölkerung galt. Er war zunächst Vizegouverneur, dann ab 1563 Gouverneur der heutigen Provinz Tucumán in Argentinien. Heute steht in einer südlichen Nachbarprovinz von Tucumán, La Rioja, der berühmteste Olivenbaum Argentiniens, in Aimogasta/Arauco, "El olivo viejo". Der Legende nach überlebte er durch die List einer alten Frau die Olivenhainzerstörung unter dem Vizekönig von Peru Pedro Fernández de Castro (Amtszeit 1667-1672).
De Castro war es nicht gelungen, den Olivenanbau in der Region völlig zu stoppen, in der Folge entwickelte sich in Argentinien die autochthone Sorte Arauco und aus dem 18. Jahrhundert sind die ersten Olivenmühlen überliefert. Im 19. Jahrhundert kam es durch Einwanderer aus Spanien und Italien zu einem Aufschwung im argentinischen Olivenanbau, mit Sorten aus diesen Ländern. Allerdings konnte Spanien den Olivenmarkt weiterhin dominieren. 1932 wurde ein Gesetz zur Förderung des argentinischen Olivenanbaus verabschiedet, verbunden mit hohen Zöllen für spanische Olivenprodukte. 1954 wurde dann regierungsamtlich die Parole ausgegeben "Haga patria, plante un olivo", "Schaffe Heimat, pflanze einen Olivenbaum".
In den 1960er Jahren wurden dann ca. 50% der argentinischen Olivenhaine gerodet, um dem Weinbau Platz zu machen. Doch während es im Weinhandel finanziell auf und ab ging, entwickelten sich die Preise für Olivenöle bald sehr vorteilhaft, so dass es in den 1990er Jahren wieder zu Neupflanzungen kam.
Argentinien steht heute an der Spitze unter den amerikanischen Ländern im Tafelolivenanbau, mit 95.000 Tonnen 2017, gefolgt von Peru mit 71.000 Tonnen. Auch in der Olivenölproduktion steht Argentinien in den Amerikas an der Spitze, weltweit 2014 an 10. Stelle mit 28.100 Tonnen, Chile weltweit an 16. Stelle mit 15.600 Tonnen, gefolgt von den USA mit 12.000 Tonnen. Große Anstrengungen zum Aufbau einer Olivenölindustrie unternimmt auch der kleine Nachbar Uruguay - wobei vor allem auf Qualität gesetzt wird. Die Produktionsmenge betrug 2012 allerdings nur bescheidene 500 Tonnen, bis 2017 wurde eine Verdoppelung erreicht. Peru möchte seine Olivenölproduktion auch steigern, wie Pressemitteilungen der "Asociación Pro Olivo" von 2017 nahelegen.
Olivenernte laut FAO 2016: 0,175 Mio Tonnen.
Im Roman "Die Reise in den Westen", vor 1592 (Datierung der ältesten erhaltenen Ausgabe) erstmals erschienen, wird in der vom "Chinese Text Project" verwendeten Ausgabe (die nicht der Ausgabe Xiyou Zhengdaoshu entspricht, die der neuesten deutschen Übersetzung 2016 zugrunde liegt) die Olive gemeinsam mit Apfel, Lotus und Trauben genannt, im 82. Kapitel, 11. Abschnitt, in der Beschreibung eines Mahls im Pavillon einer Dämonin, sowie im 100. Kapitel, 9. Abschnitt, zwischen Melone, Apfel und Lotus in der Beschreibung eines kaiserlichen Banketts in Chang'an (damalige Provinz Shanxi, heute Hebei). Auch hier bleibt unklar, welche Frucht gemeint ist, die von Olea europaea oder die von Canarium album.
Das jüngste Dokument der chinesischen Kulturgeschichte zu "Gan Lan Shu" (Olivenbaum) ist das äußerst beliebte gleichnamige Lied der Chinesisch-Taiwanesischen Autorin Chen Ping (1943-1991), die auch bekannt ist unter den Künsternamen San Mao/Drei Haare und Echo. Cheng Ping studierte in Spanien und in Deutschland Philosophie, Sprachen und Literatur, lebte insgesamt etwa 12 Jahre in Europa (u.a. auf den Kanarischen Inseln) und den USA, war verheiratet mit einem Spanier, der 1979 beim Tauchen ertrank. Der Olivenbaum, zweifellos Olea europaea, ist ein Sehnsuchtssymbol in ihrem Lied, das von unterschiedlichen Interpretinnen in China vorgetragen wird, besonders spektakulär 2013 beim "Super Girl"-Wettbewerb (der etwa dem britischen Format "Pop Idol" bzw. dem deutschen Format DSDS entspricht).
Für China sind im 20. Jahrhundert die Olivensorten "Nikitskaja", in den Provinzen Hubei, Jiangsu, Shaanxi, Sichuan und Yunnan, sowie "Krimskaja" in Jiangsu, Shaanxi und Sichuan belegt. Sie dürften in der Sowjetzeit von der Krim nach China gelangt sein. Dazu die Sorte "Kalinjot" ("Kalin", "Kanine"), die 1964 und/oder 1970 aus Albanien nach China kam, dokumentiert in Hubei, Shaanxi, Sichuan und Yunnan, ferner aus Albanien "Kallmet" (Sichuan) und "Pulazeqin" (Hubei, Sichuan). Auffallend ist auch der Anbau der froststabilen französischen "double use" Sorte "Grossane". Daneben finden sich weitere europäische Varietäten in China, so Leccino in Yunnan. In chinesischen Kollektionen werden jedoch auch im Westen unbekannte Varietäten geführt, teilweise mit der Herkunftsangabe "China", so "Baohai"/"Hanzhong", "Chengdu" (Ascolana Tenera Klon), "Gioufong" (sowjetischen Ursprungs), "Haiko".
Besonders interessant an Chinas Olivenanbau ist der Anbau in sehr unterschiedlichen Regionen, zumeist fernab aller Meere, unter unterschiedlichen klimatischen Gegebenheiten. Offenkundig unternimmt das Landwirtschaftsministerium gegenwärtig (Stand 2017) massive Anstrengungen, den Olivenanbau zu fördern - als Maßnahme zur Entwicklung des ländlichen Raums, zur Bekämpfung der Versteppung sowie zur Befriedigung des wachsenden einheimischen Bedarfs an Olivenöl. In zehn bis zwanzig Jahren könnte China durchaus zu einem ernsthaften Konkurrenten für europäische Produzenten werden, insbesondere für seinen bisherigen Hauptlieferanten Spanien.
Mit einer Produktionsmenge von 5.000 Tonnen Olivenöl aus 25 Mühlen liegt China 2015 allerdings lediglich etwa gleichauf mit Frankreich - bei einer siebzehneinhalbfach größeren Landfläche (bezogen auf Frankreich ohne Überseegebiete), geeigneteren Klimazonen und einem breiteren Sortenspektrum. Das Aufholpotential ist enorm.
In der kleinen Eiszeit, die mit dem 15. Jahrhundert beginnt, verschwindet dieser Olivenanbau wieder. Einen Neustart gibt es im 18. Jahrhundert. Doch regelmäßige Frostereignisse verhindern die Entwicklung von Olivenhainen mit alten Beständen. Der Olivenanbau in Frankreich ist geprägt durch eine niedrigstämmige Vasenerziehung, wie sie etwa die Olivenbilder van Goghs zeigen.
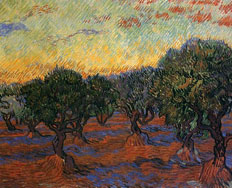 Gekennzeichnet auch durch die
sogenannte "Plantation en butte", eine leicht erhöhte
Pflanzung, häufig unterstützt noch durch Anschüttungen.
Diese Pflanzungsform wird heute begründet damit, dass die
Wurzeln so in niederschlagsreichem Klima vor Fäulnis bewahrt
werden.
Gekennzeichnet auch durch die
sogenannte "Plantation en butte", eine leicht erhöhte
Pflanzung, häufig unterstützt noch durch Anschüttungen.
Diese Pflanzungsform wird heute begründet damit, dass die
Wurzeln so in niederschlagsreichem Klima vor Fäulnis bewahrt
werden.Der Extremfrost im Februar 1956 brachte dann erneut eine Zäsur für den französischen Olivenanbau. Dazu beigetragen haben allerdings neben dem Frost auch wirtschaftliche und agrarpolitische Gründe. Innerhalb Europas machte ein französischer Olivenanbau ökonomisch keinen Sinn, die EU-Agrarpolitik förderte daher die Umstellung von Oliven auf Kirschen. Da zudem die Kunden überwiegend nicht bereit waren, für französisches Olivenöl einen Preis zu bezahlen, der weit über den Angeboten aus Spanien und selbst Italien lag, konnte sich der Olivenanbau nur in kleinen Nischen halten, etwa bei Nyons, mit einem hohen Anteil an Tafeloliven.
Mit Veränderungen im Kundenverhalten, etwa einem neuen Interesse an lokalen Produkten, und der klimatischen Entwicklung, die in Südfrankreich zu besonders starken Erwärmungen (im europäischen Vergleich) führt, wird der Olivenanbau in Frankreich seit der Jahrtausendwende erneut zu einem breiter aufgestellten Thema. Allerdings häufen sich auch schon wieder (Stand Ende 2017) Krisenberichte zu Nachwuchsproblemen bei den Olivenanbauern, Olivenfliegen und erfrorenen Blüten.
Frankreich trägt zur Olivenkultur wichtige Erfahrungen mit dem Olivenanbau unter frostigen und feuchten Grenzbedingungen bei. Die Sorte Aglandaou verweist auf die Züchtung froststabiler Sorten auf der Krim im 19. Jahrhundert (Sorte "Nikitskaja"), die "Plantation en butte" ist ein eigenständiger französischer Beitrag zur Adaption des Olivenanbaus an klimatisch schwierige Rahmenbedingungen.
Olivenernte laut FAO 2016: 0,023 Mio Tonnen.
Nach Griechenland kam der Kulturolivenanbau vermutlich aus dem Nahen Osten, über die Vermittlung phönizischer Händler und Siedler. Genaue Daten lassen sich bislang nicht nennen, aber auf Kreta gab es Olivenanbau bereits im 3. vorchristlichen Jahrtausend, im Kontext der kretisch-minoischen Kultur. Es gibt auch Spekulationen, dass auf Kreta autochthon die Kulti
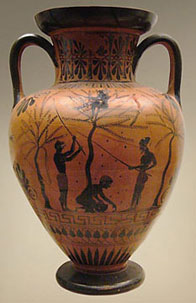 vierung der
Wildolive bereits im 4. vorchristlichen Jahrtausend
stattfand. Einer der ältesten bekannten Olivenbäume der Welt
steht auf Kreta, in der Nähe von Kolymvari, und soll etwa
5000 Jahre alt sein. Mit Carbonanalyse nachgewiesene 3500
Jahre hat der Olivenbaum von Vouves auf dem Buckel. Beide
befinden sich im äußersten Nordwesten der Insel. Im Palast
von Knossos wurden schriftliche Aufzeichnungen zum
Olivenanbau aus dem 14. vorchristlichen Jahrhundert
gefunden.
vierung der
Wildolive bereits im 4. vorchristlichen Jahrtausend
stattfand. Einer der ältesten bekannten Olivenbäume der Welt
steht auf Kreta, in der Nähe von Kolymvari, und soll etwa
5000 Jahre alt sein. Mit Carbonanalyse nachgewiesene 3500
Jahre hat der Olivenbaum von Vouves auf dem Buckel. Beide
befinden sich im äußersten Nordwesten der Insel. Im Palast
von Knossos wurden schriftliche Aufzeichnungen zum
Olivenanbau aus dem 14. vorchristlichen Jahrhundert
gefunden.Eventuell schon mit der mykenischen Kultur, spätestens aber im Kontext der phönizischen Blütezeit zwischen 1.200 und 900 v.Chr. etablierte sich der Olivenanbau auf dem griechischen Festland. Wie Herodot überliefert, gab es bei einem Tempel auf der Akropolis einen Brunnen mit Meerwasser und einen Ölbaum. Einer Legende zufolge seien dies Gaben der Göttin Athene und des Gottes Poseidon, die sich um die Herrschaft über Attika stritten.
Für die griechische Olivenkultur charakteristisch ist die Verbindung mit Ziegen. Olivenhaine wurden in der Regel mit Ziegen beweidet, was zur Folge hatte, dass es zwangsläufig zu einer Stamm"erziehung" kam, da die Ziegen regelmäßig die unteren Zweige abweideten. Noch heute sind in alten Olivenhaine gelegentlich verrostete Eisengitter in den Bäumen zu finden, die in jüngerer Zeit verhindern sollten, dass Ziegen in den Baum zum Weiden steigen. Der damit "typische" griechische (und auch etruskische?) Hochstamm ist sehr schön auf einer Amphore aus Vulci, ca. 520 v. Chr., British Museum London, zu sehen, wo mit langen Stangen gerade Oliven herabgeschlagen werden zur Ernte. Es gibt allerdings gelegentlich auch die Auffassung, Oliven hätten als Abwehr gegen Pflanzenfresser die Buschform entwickelt.
Griechische Olivenhaine hatten immer wieder unter Frostereignissen zu leiden, davon berichtet Giovanni Presta 1794 in "Degli ulivi", wo er über Griechenland als Olivenanbauland schreibt: "ha l'inverno siccome l'ha la Germania". Aus jüngerer Zeit sind die für viele griechische Olivenhaine fatalen Frostereignisse von 1956 und 2001 überliefert. Allerdings sind die griechischen Olivenhaine in der Regel weniger anfällig gegen Krankheiten und leiden seltener unter Trockenheit als etwa italienische oder spanische.
Griechenland hat lange versäumt, sein Olivenöl selbst international zu vermarkten und stattdessen den größten Teil nach Italien ausgeführt, auf dass es dort "italianisiert" und zu "extra vergine" werde. Erst in jüngerer Zeit zeichnet sich eine Wende ab. Vor dem Hintergrund, dass Griechenland der drittgrößte Olivenproduzent in Europa ist nach Spanien und Italien, könnte dies zu spürbaren Verschiebungen auf dem Olivenölmarkt führen.
Olivenernte laut FAO 2016: 2,34 Mio Tonnen.
Von iranischer Seite wird gar spekuliert, ob der allgemein erste Zuchtolivenanbau nicht im heutigen altaserbaidschanischen Grenzgebiet zur Türkei stattgefunden habe. Allerdings verweist das Lehnwort "Zaytun" für Olive auf die Levante als Herkunftsort des persischen Olivenanbaus. Eine spanisch-iranische Untersuchung (Sadeghi und Caballero 2004) zu den Verwandtschaftsbeziehungen zwischen iranischen und mediterranen Olivenvarietäten erbrachte zum einen eine erhebliche Varianzbreite bei den iranischen Olivensorten, zum anderen den Hinweis, dass einige der iranischen Sorten auf eine gemeinsame Herkunft mit den Mittelmeersorten verweisen, andere auf Abhängigkeit von diesen. Zudem zeigte sich - wie schon in anderen Untersuchungen - die enorme Adaptabilität von Oliven. Gruppen unterschiedlicher Sorten entwickeln am gleichen Standort offenkundig ähnliche morphologische Eigenschaften.
Die Anbaufläche umfasst heute etwa 100.000 Hektar, wobei Trockenheit die Flächen zwischen 2010 und 2015 erheblich reduzierte. Die großflächige Umstellung auf Tropfbewässerung führte zu einer Erholung. Die Hauptanbaugebiete liegen in den südlichen Provinzen Kotschestan, Fars, Kerman, Hormozgan, Sistan-Belutschistan und den nördlichen (am Kaspischen Meer gelegenen) Provinzen Zandschan, Qazvin, Gilan und Golestan. Spezifisch iranische Olivenvarietäten konzentrieren sich in der wichtigsten Oliven-Provinz Gilan im Nordwesten, vor allem im Tal des Sefid Rud, der ins Kaspische Meer fließt. Die Hauptvarietäten sind Dakal, Dezful, Fishomi, Gelooleh, Khara, Khormazeitoon, Mari, Rowghani, Shengeh und Zard. Die Fülle autochtoner Sorten verweist darauf, dass der Iran für die Olivenkultur des 21. Jahrhunderts mehr Aufmerksamkeit verdient, insbesondere unter den Bedingungen der Klimaerwärmung.
Olivenernte laut FAO 2016: 0,085 Mio Tonnen.
Im Römischen Reich wurde der Olivenbaum rasch zu einer der wichtigsten Wirtschaftspflanzen, mit einer Verdienstspanne, wie sie sonst nur noch der Weinbau erbrachte. Allerdings befanden sich die Hauptanbaugebiete nicht in Italien selbst, sondern in Tunesien (auch Kornkammer des römischen Reiches) und Spanien. Was die enorme Bedeutung der Punischen Kriege für die weitere Entwicklung Roms unterstreicht.
Die mittelalterliche Frostperiode reduzierte den Olivenanbau in Italien erheblich, vor allem in den nördlichen, aber auch in den mittelitalienischen Lagen. Die politischen und sozialen Wirren und Umbrüche nach dem Niedergang des Römischen Reiches trugen das ihre zum Niedergang bei. Ab dem 11. Jahrhundert kam es zu einer Renaissance des Olivenanbaus, im Norden auch mit kältebeständigeren Sorten, verbreitet durch Benediktinerklöster. Die kleine Eiszeit brachte dann einen weniger drastischen Rückgang. Offensichtlich wurden in Mittelitalien die Olivenhaine nach Kalamitäten immer wieder neu aufgebaut. Im Norden erlosch der Olivenanbau allerdings wieder. Der Winter 1984/85 brachte dann auch für den (wegen der Qualität des Öls und der landschaftsprägenden Gestalt der Haine) gerühmten Olivenanbau in der Toskana fast das Ende. Mit neuen Erziehungstechniken und Pflanzen wurde ein erfolgreicher Neubeginn gestartet. Seit Ende des 20. Jahrhunderts wird auch in Norditalien der Olivenanbau wieder intensiver betrieben.
Die Angaben zur Olivenölproduktion in Italien sind widersprüchlich. Zum einen steht Italien an zweiter Stelle unter den Olivenölproduzenten weltweit, hinter Spanien, vor Griechenland. Zum anderen wurde 2011 festgestellt, dass 80% des in Italien als italienisch vermarkteten Olivenöls der Qualität "Extra Vergine" aus Spanien, Tunesien und Griechenland stammte. Was daran liegt, dass Italien der wichtigste Olivenölvermarkter weltweit ist.
Olivenernte laut FAO 2016: 2,09 Mio Tonnen.
Spanien ist heute der weltgrößte Olivenproduzent mit ca. 7,8 Millionen Tonnen im Jahr 2013 (Italien folgt auf Platz 2 mit ca. 3 Millionen Tonnen, Griechenland auf Platz 3 mit ca. 2 Mio Tonnen). Diese Zahlen nennen wohlgemerkt die Olivenernte, nicht die Ölausbeute. Für 1 Liter Olivenöl benötigt man 5-10 Kilogramm Oliven, je nach Sorte, Reifegrad der Oliven und Ölgewinnungsverfahren rsp. Qualität des erzielten Öls.
Das heutige spanische Sortenangebot mit ca. 200 Varietäten entspricht noch weitgehend dem im 15. Jahrhundert. Spanische Sorten/Selektionen zeichnen sich durch besondere Trockenheitsresistenz aus. Dennoch ist der Anbau in Spanien in den vergangenen Jahren erheblich durch Trockenstress gefährdet. So gab es 2014 eine massiv reduzierte Ernte, nachdem bereits das Jahr 2013 erhebliche Rückgänge gebracht hatte.
Die Gründe für die Ernteeinbrüche 2013 und 2014 liegen u.a. in der Ausweitung des Olivenanbaus auch in weniger geeignete Gebiete, im Anbau von ertragreichen Sorten mit hohem Wässerungsbedarf sowie in der massiven Umleitung von Wasserströmen in die Obst- und Gemüseanbaugebiete etwa in Almeria. Dazu kamen, so heißt es, ungünstige Wetterlagen mit mal zu wenigen, mal zu vielen Niederschlägen, was auch die Olivenfliege begünstigte. Wie es scheint, bedeutet die aktuelle Klimaerwärmung für Spanien tendenziell geringere Niederschläge - allerdings sind die Daten je nach Region extrem unterschiedlich.
Für die Zukunft ist in Spanien mit weiteren Ernteeinbrüchen zu rechnen. Außerdem wird die Marktsituation ungünstiger durch den Aufbau eigener Olivenölproduktionen in Ländern, die bislang in großem Umfang von Spanien beliefert wurden.
Olivenernte laut FAO 2016: 6,56 Mio Tonnen.
Eine Domestikation dieser Subspezies wurde bislang noch nicht nachgewiesen. Bislang wird in der Forschung nur Olea europaea subsp. europaea als Domestikationsgrundlage angenommen - was allerdings eher auf Konventionen als auf wissenschaftlichen Daten beruht. Im angelsächsischen Raum begegnet subsp. europaea auch gelegentlich als Domestikationsfolge von subsp. africana.
Der Olivenanbau in Nordafrika ist bis in die Zeit der Phönizier gut belegt. Aus anderen Teilen Afrikas gibt es (bislang) keine Daten zu einem Olivenanbau vor Beginn der Neuzeit oder gar zu einer autochthonen Olivendomestikation. Nach Südafrika kamen die ersten dokumentierten Oliven durch den Arzt und Kaufmann Jan van Riebeeck, den Begründer Kapstadts und ersten Gouverneur der niederländischen Kapkolonie. In seinem Tagebuch notiert er am 6. August 1659: "The season is also approaching for planting and grafting the olive".
1903 kam der italienische Olivenzüchter Ferdinando Costa nach Südafrika und erkannte am Gedeihen der Wildoliven an den Hängen des Tafelberges das Potenzial der Region für einen kommerziell erfolgreichen Olivenanbau. Er brachte Oliven aus Italien ins Land und vermehrte diese über Propfung auf Wildoliven als Unterlage. In der Folge baute er auch eine Olivenmühle und verbreitete den Olivenanbau auch unter anderen Farmern der Region.
In den 1990er Jahren wurde nach dem politischen Umbruch in Südafrika der Olivenanbau forciert und modernisiert. 2018 konnte Südafrika ein Drittel seines Olivenverbrauchs aus heimischer Produktion decken.
Aus dem heutigen Israel, einer straßenbaubedingten Notgrabung in der Nähe von En Zippori, stammt das bislang älteste Dokument der Olivenkultur, ein Tongefäß aus dem 6. Jahrtausend v. Chr., das Spuren von Olivenöl enthielt. Es kann sich dabei allerdings auch um Öl der Wildolive handeln. Unklar ist zudem, ob das Öl am Fundplatz produziert wurde oder ob es als Handelsware nach En Zippori kam. Als Handelsware dürfte es aus dem Raum Syrien/Jordanien gekommen sein. In der kupferzeitlichen Ausgrabungsstätte el-Khawarij im jordanischen Hochland wurden bei archäologischen Erkundungen größere Mengen karbonisierter Olivenkerne aus dem 5. vorchristlichen Jahrtausend gefunden.
Am 60 Kilometer südwestlich von Aleppo gelegenen Tell Mardikh wurden dann im 3. vorchristlichen Jahrtausend gesichert in großem Stil Zuchtoliven angepflanzt. Den 1975 entdeckten Lehmtafeln von Tell Mardikh zufolge (die auf 2500-2250 v. Chr. datiert werden), besaß einer der Könige von Ebla einen Olivenhain von 1.430 Hektar. Der Olivenanbau in der Kultur von Ebla, die zwischen 2500 und 1600 - mit einer langen Unterbrechung - florierte, trug wesentlich dazu bei, Ebla die wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit von Mesopotamien zu sichern. Bekannte syrische Olivensorten sind Dan, Doebli, Hemplasi, Insassy, Jlett/Jlott, Kaissy, Karamani, Khodairi/Khodeiri, Nibali/Nabaly, Qaisi, Safrawi, Sorani, Souri, Zayti/Zaity und Zor. Die syrische Olivenölindustrie hat sich lange Zeit vorrangig nach Quantität, nicht nach Qualität orientiert. Erst in den 2010er Jahren fand eine Umorientierung statt. Nachdem 2012-2015 der syrische Olivenölexport durch Umstellungsprozesse und Kriegshandlungen eingebrochen war, wurden 2016 über 20.000 Tonnen Öl exportiert, die höchste Menge seit 2006.
Im 7. Jahrhundert wurde in Syrien die Seifensiederei aus Olivenöl entwickelt, ein Industriezweig, der sich rasch entwickelte und schon im frühen Mittelalter überregional bedeutsam wurde. Noch heute genießen die Olivenseifen aus Aleppo einen legendären Ruf, wenngleich kriegsbedingt die Produktion stark zurückgegangen ist.
Olivenernte laut FAO 2016: 0,899 Mio Tonnen.
Wir können davon ausgehen, dass es bereits in der mittleren Bronzezeit Olivenanbau in der Toskana gab, mit Einflüssen möglicherweise aus der mykenischen Kultur. Ob die Etrusker dann diesen Olivenanbau weitergeführt haben und/oder eigene Domestikationen entwickelten bzw. mitbrachten, darüber können wir bislang nur spekulieren. Dass die Griechen von Euboia dann einen Einfluss auf die etruskische Olivenkultur hatten, dürfen wir annehmen. Ob die Griechen den an Artefakten-Funden nachgewiesenen Handelskontakt mit der Levante vermittelten oder die Phönizier selbst auch präsent waren, wissen wir nicht. Allerdings interessierten die Etrusker sich beim Handel mit den Euboiern vor allem für Keramik und Gold, während sie die Griechen u.a. mit Eisen versorgten.
Oliven dürften in der Ernährung der Etrusker eine wichtige Rolle gespielt haben. Funde von Öllampen verweisen darauf, dass Olivenöl auch als Leuchtmittel und im religiösen Kultus verwendet wurde. Der etruskische Olivenanbau und die damit verbundene Kultur wurde dann von den Römern übernommen, als sie Etrurien ab 400 v. Chr. sukzessive eroberten oder integrierten. Der angenommen älteste Olivenbaum der Toskana steht südlich von Grosseto, am Rand der Ortschaft Magliano in einem Olivenhain. Sein Name ist "Strega di Magliano", sein Alter wird geschätzt auf 3000-3500 Jahre. Eine genetische Untersuchung seiner Verwandtschaftsbeziehungen könnte Aufschluss über die Frühgeschichte des Olivenanbaus in der Toskana geben.
In der frühmittelalterlichen Kältezeit, verbunden mit dem Niedergang des römischen Reiches, ging der Olivenanbau massiv zurück, um im Hochmittelalter unter günstigeren klimatischen Bedingungen und vorangetrieben durch benediktinische Klöster wieder einen Aufschwung zu erleben. In der kleinen Eiszeit (Höhepunkt in Italien zwischen 1645 und 1715 - "Maundner-Minimum" der Sonnenfleckenaktivität) kam es vor allem in nördlichen oder hochgelegenen Anbaugebieten zu einem erneuten Rückgang durch Frostereignisse, mit einer deutlichen Zäsur durch den extremen Frost von 1709. Die Aufklärung brachte dann die Landwirtschaft der Region auch im Bereich des Olivenanbaus erheblich voran. Maßgeblich wurde dabei das Werk des Pistoieser Agronomen Cosimo Trinci, "L'agricoltore sperimentato", erstmals erschienen 1726. Er verzeichnet auch die fatalen Frostereignisse in der Toskana bis 1709 und gibt Hinweise darauf, wie der Olivenanbau darauf angemessen reagieren könne.
Der Jahrhundertfrost vom Februar 1956 hat die Toskana nur am Rand erreicht, während er für Südfrankreich das Ende des volkswirtschaftlich relevanten Olivenanbaus bedeutete. Doch der Frost von Januar/Februar 1985 hatte dann auch für die Olivenhaine der Toskana katastrophale Folgen. 18 Millionen der 20 Millionen Olivenbäume wurden zerstört oder zumindest nachhaltig geschädigt. Unter Federführung der 1966 bei Follonica gegründeten Azienda Sperimentale "Santa Paolina" wurde ein Neuaufbau der toskanischen Olivenhaine initiiert - der allerdings nur vorwegnahm, was die EU-Landwirtschaftspolitik ohnedies in weiten Teilen Italiens, Spaniens und Griechenlands auch ohne Frostfatalitäten bewirkte: Den Ersatz von streuobstwiesenähnlichen Olivenhainen mit alten Bäumen und ausladenden Kronenbildungen durch ertragsorientierte Anlagen mit niedrigwüchsigen Jungoliven.
Stand 2020 stehen in der Toskana wieder etwa 14 Millionen Olivenbäume auf 93.000 Hektar Anbaufläche.
Im 19. Jahrhundert war der Olivenanbau in Kalifornien dann etabliert und 1884 plante eine Gruppe von 67 deutschsprachigen Siedlern Olivenanbau in einer Siedlung, der sie gar den Namen "Olivenhain" gaben. Die Oliven für ihr Vorhaben hatten sie nicht mitgebracht, sie sollten diese vor Ort von dem Betrüger erhalten, der ihnen auch das unfruchtbare und sehr trockene Land verkauft hatte. Aus dem Olivenanbau wurde nichts, aber der Name der Siedlung existiert bis heute und dokumentiert die Anstrengungen zwischen dem Olivenanbau im Ausgang von mexikanischen Missionen und dem modernen Olivenanbau in Kalifornien.
Im nordamerikanischen Südosten wurde der Olivenanbau verschlafen. Am 12. Januar 1813 schrieb der Olivenenthusiast und Ex-Präsident Thomas Jefferson (Zitat: "The olive tree is surely the richest gift of heaven") von seinem Landgut Monticello im Bundesstaat Virginia - wo Oliven zu seinem Bedauern nicht fruchteten - an seinen langjährigen Briefpartner in landwirtschaftlichen Dingen, den Geschäftsmann, Letterngießer und Farmer James Ronaldson in Philadelphia: "It is now 25 years since I sent them ("our Southern fellow citizens" - H.Sch.) two shipments (about 500 plants) of the olive tree of Aix, the finest olive in the world." Die "Non-chalance" der Südstaatler, deren Klima Jefferson für solche Versuche geeignet schien, habe jedoch dazu geführt, dass bestenfalls einige Oliven in Vorgärten gelandet seien, kein einziger Hain sei angelegt worden. Leider wissen wir nicht, um welche Sorte es sich handelte.
Auch heute setzt man selbst in Florida eher auf Zitrusfrüchte denn Oliven. In jüngerer Zeit gibt es allerdings breiter angelegte Versuche, den Olivenanbau dort zu etablieren. Motiviert unter anderem durch grassierende Erkrankungen in den Zitronenplantagen.
Olivenernte laut FAO 2016: 0,159 Mio Tonnen.
Die Entscheidung fiel nach einer Überlieferung durch den mythischen Stadtgründer Kekrops, nach einer anderen durch einen Götterrat. Nach einer Version der Legende, die Poseidon etwas wohlwollender bedenkt, bot dieser zunächst einen Süßwasserbrunnen. Als die Athener sich jedoch gegen ihn entschieden, lieferte dieser Brunnen nur noch Salzwasser. Und nach einer ganz anderen Variante bot Poseidon das Pferd. Der Olivenbaum ist aber auch in dieser Variante die Gabe Athenas.
In der islamischen Mystik, bei den Derwischen, den "Armen" (pers. "darwisch" - der Arme) spielt die Olive eine besondere Rolle dank ihrer vielfältigen symbolischen Bezüge, etwa zum Licht über die Verwendung des Öls in Lampen. Häufig wird im Sufismus Vers 35 aus der 24. Sure zitiert. Da wird das Licht Allahs verglichen mit dem Licht einer Öllampe, deren Brennstoff "kommt von einem gesegneten Baum, einem Ölbaum, weder östlich noch westlich, dessen Öl beinahe schon Helligkeit verbreitet, auch wenn das Feuer es nicht berührt".
Der britische Sufi Reshad Feild (1934-2016) berichtet in der Autobiographie seiner religiösen Entwicklung, "Ich ging den Weg des Derwisch" (dt. 1977, zuvor engl. 1976), wie sein erster Lehrer, "Hamid", ihn lehrte, perfekte Oliven zuzubereiten (S. 59). Einige Seiten später wird erläutert, dass es nicht nur um ein Rezept zur Herstellung schmackhafter Speiseoliven ging, sondern um den Weg der eigenen Entwicklung, der in einer "zweiten Taufe" kulminiere, ähnlich wie der Olive zum Abschluss des "Rezeptes" ihre eigene Essenz, Olivenöl, hinzugefügt werde (S. 67).
Güneli Gün lässt ihre hungrige Heldin Hürü aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts in "Der Weg nach Bagdad" (1992) bei der Bestattung eines Derwischs zunächst zur Stärkung trockenes schimmliges Brot essen und dann den Kern einer Olive schlucken.
Im 10. und 11. Jahrhundert erneuerten die Benediktinerklöster den Olivenanbau in den nördlichen Mittelmeerregionen. Die Quellenlage hierzu ist jedoch sehr widersprüchlich. Für die Herkunft der ligurischen Sorte Taggiasca etwa werden von der Gemeinde Taggia die Benediktiner der piemontesischen Abtei San Dalmazzo da Pedona genannt, zu deren Einflußbereich Taggia gehörte (1246 wurde ihnen der Besitz der Kirche Santa Maria del Canneto in Taggia bestätigt). Die Gemeinde Seborga spricht von Mönchen der im 5. Jahrhundert gegründeten Benediktinerabtei Lérins auf der Insel Saint-Honorat, die zuerst um die Jahrtausendwende Taggiasca-Setzlinge nach Seborga gebracht haben sollen. Eine wichtige Rolle scheinen auch die Benediktiner der Abtei Saint-André von Sestri Ponente, heute Stadtteil von Genua, gespielt zu haben. Eines ihrer Schwesterklöster war San Dalmazzo da Pedona. Das Wässern und anschließende Einlegen in Salzwasser als Zubereitungsmethode für Tafeloliven wird auch "benedictine style" genannt. Taggiasca ist in Südostfrankreich auch als Cailletier bekannt.
Das Papsttum von Benedikt XVI. (Joseph Kardinal Ratzinger) stand nach den Voraussagen des irischen Zisterzienser-Mönches und Heiligen Malachias (gestorben 1148 im Kloster Clairvaux), möglicherweise eine Fälschung vom Ende des 16. Jahrhunderts, im Zeichen der Olive, "De Gloria Olivae".
Heute ist in Frankreich vor allem das Benediktinerkloster "Abbaye Sainte-Madeleine du Barroux" nördlich der Gemeinde Le Barroux/Vaucluse am Fuß des Mont Ventoux bekannt für seine Olivenölproduktion. Es beherbergt auch eine der wenigen modernen, aktiven französischen Olivenmühlen. Gegründet wurde das Kloster erst 1970, als Reaktion auf die Einführung der neuen liturgischen Ordnungen 1968. Le Barroux war seit dem 18. Jahrhundert bekannt für den Olivenanbau, bis zum Februarfrost von 1956, der - unterstützt durch die Landwirtschaftspolitik der EU - den französischen Olivenanbau weitgehend zum Erlöschen gebracht hatte. Die Mönche von Sainte-Madeleine trugen wesentlich dazu bei, die Olivenkultur in ihrer Region neu zu beleben, mit den Sorten Tanche und Aglandaou.
Auch die Mönche vom Monte Oliveto produzieren ein anerkanntes Olivenöl eigener Produktion, aus den Sorten Frantoio, Moraiolo und Leccino.
In ihrer "Physica", im Buch 3, das den Bäumen und Sträuchern gewidmet ist, geht es um die äußerliche Verwendung von Olivenöl sowie Auszügen der Rinde und der Olivenblätter. Rinde und Blätter empfiehlt sie bei "Gicht" (nicht identisch mit dem heutigen Krankheitsbild) und Magenbeschwerden, Olivenöl bei Fieber, bei Kopfschmerzen, Geschwüren, Krämpfen und - wiederum - "Gicht". Zur Ernährung solle man Olivenöl nicht verwenden, da es Übelkeit bewirken könne und schwer verdaulich sei. Die Autorin dürfte vor allem ranziges Olivenöl gekannt haben.
In "Causae et curae" nennt Hildegard von Bingen Olivenöl zur äußerlichen Anwendung bei Kopfschmerzen, Maßlosigkeit, Geschwüren/Abszessen, Vergesslichkeit (Abschnitte 407 und 460), Krämpfen, Würmern, "Gicht". Hier findet sich auch die einzige innere Anwendung von Olivenöl, im Abschnitt 421, bei Ansammlung von "schlechten und geronnenen und giftigen Säften" als Beifügung zu Salbei und leichtem Wein. Olivenöl (oder alternativ Butter) soll dabei innerlich heilen.
Wo die Autorin dabei lediglich antikes oder zeitgenössisches Schrifttum fortschreibt, wo sie auf eigene Erfahrungen mit importierten Produkten zurückgreift oder gar auf Erfahrungen mit Olivenbäumen in oder bei ihrem Kloster sich stützen kann, bleibt bislang unbestimmt. In der Hildegard-Forschung ist noch die Überzeugung anzutreffen, sie habe auch die Inhalte ihrer naturkundlichen Schriften in Visionen erhalten (vgl. Marie-Louise Portmann in der Einleitung zu ihrer Übertragung der "Physica"). Allerdings verzichtet die neuere Forschung weitgehend auf diese Annahme. So schreibt Ortrun Riha in der Einführung zu ihrer Neuübersetzung von "Causae et Curae" 2011, der "Wahrheitsgehalt" dieser Schrift liege "in der stupenden Menschenkenntnis Hildegards und in ihrer tiefen Religiosität, nicht etwa in einem wie immer gearteten Offenbarungscharakter dieser Heilkunde".
Der Olivenbaum steht in der "Physica" an 16. Position im dritten Buch. Er wird dem Mitleid zugeordnet. Vor ihm stehen Kastanienbaum, Mispel, Feigenbaum und Lorbeer, nach ihm Dattelpalme, Zitronenbaum, Zeder und Zypresse. Auch die "Exoten" unter diesen Bäumen könnten, mit Ausnahme der Dattelpalme, im mittelalterlichen Wärmeoptimum bis in den Kölner Raum verbreitet gewesen sein.
Angeblich trugen die Kommissäre der französischen Revolutionsregierungen Olivenzweige in der Hand, die ihre naturrechtliche Legitimation anzeigen sollten, als Amtssymbol in Anlehnung an das Rutenbündel der römischen Verwaltung.
Die französische Revolution beseitigte alle Hoheitszeichen der Monarchie. Das 1905 neu eingeführte Hoheitszeichen Frankreichs zeigt ein Liktorenbündel, umgeben von Eichen- und Olivenzweigen mit Blättern.
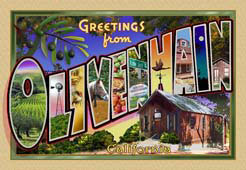 Südwestküste
der USA, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Mexiko, an der
heißen und trockenen Pazifikküste. Dort hatten sich 1884
siebenundsechzig deutschsprachige Siedler niedergelassen -
mit der Absicht, im südlichsten Kalifornien Oliven
anzubauen. Aus dem Olivenprojekt wurde jedoch nichts, einer
der Koloniegründer war ein Betrüger, Theodore Pinther, der
mit schlechtem Boden, zu dessen Vorbesitzern auch ein Marcus
Schiller gehört hatte, ein Vermögen machte. Es gab nicht
genügend Wasser und die Kolonie löste sich nach
Streitigkeiten teilweise wieder auf. Aber einige der Siedler
waren ähnlich zäh wie der Olivenbaum, den sie sich zum
Symbol gewählt hatten, und bald gab es sogar eine erste
Schule.
Südwestküste
der USA, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Mexiko, an der
heißen und trockenen Pazifikküste. Dort hatten sich 1884
siebenundsechzig deutschsprachige Siedler niedergelassen -
mit der Absicht, im südlichsten Kalifornien Oliven
anzubauen. Aus dem Olivenprojekt wurde jedoch nichts, einer
der Koloniegründer war ein Betrüger, Theodore Pinther, der
mit schlechtem Boden, zu dessen Vorbesitzern auch ein Marcus
Schiller gehört hatte, ein Vermögen machte. Es gab nicht
genügend Wasser und die Kolonie löste sich nach
Streitigkeiten teilweise wieder auf. Aber einige der Siedler
waren ähnlich zäh wie der Olivenbaum, den sie sich zum
Symbol gewählt hatten, und bald gab es sogar eine erste
Schule. Heute leben etwa 1500 Familien in Olivenhain, das nun zur Stadt Encinitas gehört, einmal jährlich wird Ende April das "Bratwurst and Beer Fest" gefeiert - zur Erinnerung an die Gründergeneration aus Deutschland. Dank moderner Bewässerung wächst inzwischen Wein in Olivenhain. Und einige Olivenbäume gibt es auch schon. Es hat damit nur ein bisschen länger gedauert, als geplant.
Ein Spezifikum der Gemeinde ist die mir sehr sympathische "Dark Sky Policy": Lichtverschmutzung wird massiv angegangen. Unlängst kämpften die Leute von Olivenhain um das Recht auf den nächtlichen Sternenhimmel gegen einen Supermarktneubau in der Nachbarschaft, der mit protzigen Illuminationen die Nacht für sich reklamieren wollte. Olivenhain gewann.
Im zaristischen Russland gab es Importoliven aus Südfrankreich, genannt "provenzalische Oliven". In der Sowjetunion gab es dann durchaus Olivenanbau, das Produkt war grundsätzlich im eigenen Lebensmittelangebot - allerdings in sehr geringem Umfang und vorwiegend regional. Die Versorgung der Sowjetunion mit Speiseöl leistete in den 1960er Jahren die Sonnenblume - darüber gibt etwa die vom United States Department of Agriculture veröffentlichte "Midyear Review" des ERS/Economic Research Service-Foreign von 1966 Auskunft. Olivenanbau zur Ölproduktion war den sowjetischen Versorgungsplanern offenkundig zu ineffektiv. Georgien etwa, ein uraltes Olivenanbauland, war primär für die Weinproduktion vorgesehen. Einen bescheidenen Olivenanbau gab es in der Sowjetunion außer in Georgien noch auf der Krim, in der südrussischen Region Kuban, in Aserbeidschan, Tadschikistan und Turkmenistan.
Ansonsten gab es Olivenanbau im Horizont der DDR noch in den Balkanländern. Und von dort brachten einige DDR-Bürger auch mal Oliven und Olivenöl vom Urlaub mit in die Heimat. Ob diesen Produkten allerdings tatsächlich das Image eines begehrten Genussgutes anhaftete, wie Schirmers Erinnerung im "Silberblick" nahelegt, scheint mir zweifelhaft. Die Autorin Claudia Rusch weist in einem klugen Beitrag für "chrismon" vom 01.02.2008, "Essen im vereinten Deutschland", darauf hin, dass auch in der Bundesrepublik bis in die 80er Jahre hinein das Verlangen nach "Mittelmeerdiät" eher verhalten war. "Am Rhein wie auf Rügen hieß Rucola 1990 noch Rauke und war Unkraut. Hier wie dort trank man nicht literweise Wasser, verkochte kein Olivenöl und hätte bei Sambal Oelek nicht auf Anhieb sagen können, ob es sich dabei um kenianische Brustsalbe oder doch eher um eine Tröpfcheninfektion handelt."
Seit 1991 bemüht sich unter anderem ein Quereinsteiger der Olivenölproduktion, Salvatore (genannt Sam) Cremona, in Il-Wardija im Nordosten der Insel um eine Wiederbelebung des maltesischen Olivenanbaus. Vor allem am Herzen liegt ihm dabei, neben der gleichfalls nur auf Malta zu findenden Sorte "Bidni", die "Perla Maltese". Fast wäre diese Art ausgestorben, nur noch zwei alte Bäume gab es in den 1990er Jahren auf Malta (andere Quellen sprechen davon, Cremona habe sie auf Sizilien gefunden). Cremona vermehrte sie gezielt aus Früchten, die er drei Wochen bei -5 Grad lagerte, damit sie keimfähig werden. Bekannt wurde Salvatore Cremona durch Jamie Oliver, der ihn in einem Blogbeitrag von 2014 auf seiner Website "Godfather of Maltese olive oil" nennt. Jamie Oliver weiß - wie Salvatore Cremona - zu schätzen, was den beiden Malteser Olivenvarietäten fast zum Verhängnis wurde: die intensive Bitternis.
Seit 2016 wird die Sorte "Perla Maltese" auch in einer staatlichen Landwirtschaftsanstalt gezielt vermehrt und an interessierte Landwirte ausgegeben. 2017 hat die Regierung den Züchter Salvatore Cremona gebeten, seine in Gläsern eingelegte Perla-Ernte von 2016 als Geschenk für den maltesischen EU-Ratsvorsitz zur Verfügung zu stellen. Das maltesische Wort für Oliven ist "Zejt" und verweist auf das Semitische. Der Name der maltesischen Stadt "Zejtun" bedeutet "Olivenhain". Auf Sizilien gibt es eine Olivensorte "Zaituna". Ob sich hier die phönizische Geschichte der Region widerspiegelt oder - was plausibler ist - die arabische Herrschaft im Mittelalter, ist nicht definitiv geklärt.

Bei der Recherche nach entsprechenden Sorten bin ich auf die kriechenden Oliven von Pantelleria gestoßen. Pantelleria ist eine Insel südwestlich von Sizilien, nahe an der afrikanischen Küste. Olivenbäume kamen vermutlich im 6. Jahrhundert v. Chr. mit den Phöniziern erstmals auf die Insel. Die Phönizier gründeten im Nordwesten der Insel, die sie Cossyra nannten, eine Hafenstadt und handelten vermutlich mit dem Obsidian, der auf Pantelleria abgebaut wurde.
Auf Pantelleria wurde die auch auf Sizilien und in Kalabrien bekannte Sorte Biancolilla zu kriechendem Wuchs erzogen, um den stürmischen Winden auf der Insel besser standzuhalten. Der Anbau findet auf Terrassen statt. Auch kriechende Weinstöcke, in Mulden gepflanzt, gibt es auf Pantelleria!
Wenn ich mir das Erntebild (rechts) auf der Website von "Donnafugate" anschaue, ist das eigentlich genau das, was ich mir (nach dem Abschied von der Vorstellung, in meiner Lage sinnvoll Hochstämme zu entwickeln) auch als Ideal des Pflanzenaufbaus vorstelle - für die Pflege, nicht für die Ernte (die bei mir ohnedies nicht zum Problem werden dürfte ...). Biancolilla gilt übrigens als feuchtigkeitstolerant und froststabil - was in den süditalienischen Hügellagen allerdings etwas anderes bedeutet als in Norditalien oder gar bei uns. Froststabiler ist die gleichfalls für die niedrige Buscherziehung sehr geeignete katalanische Sorte Arbequina, mit der ich 2024 einen zweiten Versuch (der erste war an Mäusen, nicht an Frost gescheitert!) in meinem Gelände startete.
Die Firma Donnafugate mit Sitz auf Sizilien, in Marsala, bewirtschaftet auf Pantelleria 5 Hektar mit 1.550 Pflanzen der Sorte Biancolilla in den Gebieten "Montagnole" und "Dietro Isola". "Donnafugate" hat sich auf qualitätsvollen Wein- und Olivenanbau in Süditalien und den Handel mit deren Produkten spezialisiert. Ihre Website ist auf Italienisch, Englisch und Deutsch zu lesen.

Man mag es für eine Spinnerei halten oder für eine Verschwendung von europäischen Fördergelder. Aber die sprechende Olive von Seggiano passt zu diesem liebenswürdigen Städtchen am Fuß des Monte Amiata, abseits der touristischen Hauptrouten Italiens, im Grenzbereich der so unterschiedlichen italienischen Regionen Toskana und Umbrien, historisch in besonderer Weise geprägt durch Etrusker, Langobarden und den blutigen Streit der toskanischen Stadtstaaten um die Vorherrschaft. Diese Olive passt zu einem Städtchen, das den opulenten Kunstgarten von Daniel Spoerri beherbergt, der Anfang der 1990er Jahre nach Seggiano kam, sowie die sagenhafte Kapelle San Rocco mit ihren kostbaren Fresken. Und eben auch die teuerste Olive der Welt, eine sprechende zumal. Immerhin 240.000 Euro EU-Fördermittel ("Leader") sind geflossen, um die alte Zisterne von Seggiano 2013/14 zu restaurieren und mit viel Beton in eine Art Aztekentempel zu verwandeln - unvollendet wie das gleichfalls EU-geförderte Dokumentationszentrum zur Metallurgie der Region mit Stadtbibliothek im Rathaus (Stand 2018).
In dieser Zisterne hängt seit 2014 oben ihr Herzstück, eine Olive der Sorte Olivastra Seggianese, die, der Name verrät es schon, charakteristisch ist für diesen Teil der Landschaft am Monte Amiata. Ihre Wurzeln wachsen frei in den Raum der Zisterne, genährt durch eine Sprüheinrichtung, die Wasser und Nährstoffe bringt - zuständig dafür ist der Agronom Fabio Menchetti. An diese Wurzeln möchte der Pflanzenphysiologe Stefano Mancuso, Direktor des "Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale" (LINV), 2018 eine aufwendige Apparatur anschließen, die das bioelektrische Aktivitätsprofil der Wurzeln aufzeichnet. Damit solle ein Beitrag geleistet werden zur Aufschlüsselung einer "Sprache der Pflanzen", woran das LINV seit Jahren arbeitet. Stefano Mancuso ist gemeinsam mit der Wissenschaftsautorin Alessandra Viola Autor des Buches "Die Intelligenz der Pflanzen", erstmals 2013 auf Italienisch erschienen. Die Koordination des Projektes vor Ort lag 2018 in den Händen von Diego Ceccarini, rühriger Kopf von "Le Radici di Seggiano".
Stand Ende 2020 hat die Olive noch nicht zu sprechen begonnen, Mancuso sammle noch Geld für sein Projekt. Stand September 2024 ist nichts weiter zu erfahren auf der inzwischen kommerzialisierten Website von "Le Radici di Seggiano" oder sonst im Netz. Mancusos letzter Besuch in Seggiano fand 2017 statt.
Betroffen sind laut einem Forschungsbericht von Peter Cuneo und Michelle Leishman, veröffentlicht 2006 in "Cunninghamia" 9(4), vor allem "drier woodlands, riverine environments, coastal headlands and dune systems". "African Olive is a declared noxious weed in NSW and South Australia, and listed nationally as a potential environmental weed". Gefährlich werde die Wildolive einmal durch ihre Konkurrenzstärke in der Wasseraufnahme, zum anderen durch den Schattenwurf dank extrem dichter Belaubung. So stelle sie im südlichen Australien eine ernsthafte Bedrohung der etablierten Biodiversität dar. Laut Cuneo/Leishman ist die Afrikanische Olive gefährlicher als die ausgewilderte Europäische dank ihrer besonderen Anpassung an trocken-heiße Bedingungen, verbunden mit Schattenverträglichkeit. Auch für die Ausbreitung von Buschfeuern wird sie verantwortlich gemacht.
Die Afrikanische Olive unterscheidet sich von der Europäischen Olive durch größere, langgezogene Blätter und einen Haken an der Blattspitze ("cuspidata" = gezipfelt, zipfelig). Ihr Wuchs ist kompakter und stärker buschförmig. Die Früchte sind kleiner und rund. Ausbreitung erfolgt über die Früchte, die von Vögeln gefressen und deren harte Kerne unverdaut in teils großen Entfernungen wieder ausgeschieden werden. Im Unterschied zu Olea europaea subsp. sylvestris ist die Subspezies cuspidata/africana als Unterlage für Zuchtoliven wenig geeignet.
Die Insel Scheria wird von Homer ähnlich beschrieben wie Atlantis bei Platon, darauf wurde schon öfter hingewiesen, insbesondere von Atlantologen. Früchte reifen das ganze Jahr über, die Bedingungen sind gleichsam paradisisch, Analogien zum Goldenen Zeitalter drängen sich auf. Es ist durchaus bemerkenswert, dass der Reichtum dieses mythologischen Ortes zunächst greifbar wird für Odysseus in Olivenöl - wobei nicht ganz deutlich wird bei Homer, ob er die Ölflasche selbst als aus Gold gemacht bezeichnet oder das Olivenöl als "golden". Wahrscheinlicher ist eher die Flasche (6/215). Die gerne Homer unterstellte Bezeichnung "flüssiges Gold" für Olivenöl dürfte ein bereitwilliges Missverstehen vor dem Hintergrund heutiger Marketinginteressen sein. "Golden" ist im übrigen ein bei Homer in der "Odyssee" sehr häufig eingesetztes Adjektiv.
 bseits der Hauptwege des
Italientourismus liegt die kleine Ortschaft Seggiano, auf
einem Hügel in der Nähe des Monte Amiata. Das dortige, als
kunsthistorisches Kleinod geschätzte Oratorio di San Rocco
wurde 1490-1493 von Girolamo di Domenico ausgemalt. Im
Zentrum steht "La Madonna col Bambino", flankiert von den
Heiligen Sebastian, Bartolomäus, Gervasius von Mailand und
Bernhard von Siena. Jedem dieser Heiligen ist ein Olivenbaum
zugeordnet. Die vier Olivenbäume sind zu identifizieren über
die Baumbasis, wo wir jeweils einen abgestorbenen Strunk
sehen und einen zugehörigen hoch aufragenden vitalen
schlanken Stamm.
bseits der Hauptwege des
Italientourismus liegt die kleine Ortschaft Seggiano, auf
einem Hügel in der Nähe des Monte Amiata. Das dortige, als
kunsthistorisches Kleinod geschätzte Oratorio di San Rocco
wurde 1490-1493 von Girolamo di Domenico ausgemalt. Im
Zentrum steht "La Madonna col Bambino", flankiert von den
Heiligen Sebastian, Bartolomäus, Gervasius von Mailand und
Bernhard von Siena. Jedem dieser Heiligen ist ein Olivenbaum
zugeordnet. Die vier Olivenbäume sind zu identifizieren über
die Baumbasis, wo wir jeweils einen abgestorbenen Strunk
sehen und einen zugehörigen hoch aufragenden vitalen
schlanken Stamm.Das Bild des Olivenbaums stand im Mittelalter und noch in der Barockzeit für besonders herausragende Persönlichkeiten im Christentum, mit Bezug auf Römer 11, 16-32. Im Brief eines Zisterziensermönches aus Maulbronn an Hildegard von Bingen wird diese als "prächtiger Ölbaum" bezeichnet. Eine Heiligenvita zu Franz von Paola von 1741 trägt den Titel "Frucht-Bringender Oliven-Baum in dem Lust-Haus der Kirchen Gottes".
In der Bildenden Kunst ist dieser Bezug meines Wissens erstmals mit diesem Fresco in Seggiano vom Ende des 15. Jahrhunderts angedeutet. Ob dahinter die konkrete Prägung der Landschaft bei Seggiano durch Olivenbäume steht, ist schwer zu entscheiden. Die vier Bäume sind individuell gestaltet, unterscheiden sich aber auch deutlich von den im Landschaftshintergrund gemalten Bäumen, was auf einen symbolischen Gehalt verweist. Aus dem 15. Jahrhundert sind zahlreiche Kältewellen in Italien überliefert, die durchaus auch einen konkreten Hintergrund für die geschädigten Oliven von San Rocco liefern könnten.
Girolamo di Domenico ist ein wenig bekanntes Mitglied der Malerschule von Siena, mit unklarer Biographie und wenigen hinterlassenen Werken. Die ins 13. Jahrhundert zurückreichende Schule von Siena war wesentlich beteiligt an der Begründung der Renaissance-Malerei, allerdings konservativer ausgerichtet als die Schule von Florenz. Sie verlor im 15. Jahrhundert gegenüber letzterer massiv an Bedeutung. Die in den Olivenbaumfresken von San Rocco sichtbare Hinwendung zur realen Landschaft verweist, neben anderen Merkmalen, auf florentinischen Einfluss.
Seggiano ist Heimat einer Olivenvarietät, die sich durch besondere Frosthärte und allgemeine Vitalität auszeichnet, "Olivastra Seggianese". Vor Ort wird die Varietät von einigen Geschichtsenthusiasten auf die Etrusker zurückgeführt. Belege dazu gibt es keine, eine Altersbestimmung besonders ehrwürdiger Exemplare der Region hat noch nicht stattgefunden, ebensowenig eine genetische Analyse der Abstammungshintergründe von Olivastra Seggianese. Die bislang als ältester Olivenbaum der Toskana bekannte "Strega di Magliano", geschätzt auf ein Alter von über 3.000 Jahren, steht in ca. 40 Kilometer Luftlinie Entfernung.
Was bei Petrarka der Lorbeer ist bei du Bellay die Olive. Und wie bei Petrarca der Lorbeer (it. "lauro") auf die geliebte Laura verweist, steht bei du Bellay die Olive für eine verehrte Frau, die er "Olive" nennt. In der Forschung streitet man sich darüber, ob damit seine Cousine Olive de Sévigné oder eine anonym gebliebene Mademoiselle Viole gemeint sei. In der antik schon begründeten Symbolik gleichen sich die beiden Pflanzen, sie stehen für Auszeichnung, für besondere Leistungen, als immergrün auch für Erneuerung, für Ewigkeit, Fortdauer.
 sen der Erholung, in denen van Gogh einige
seiner bekanntesten Werke malte ("Ein Wiegenlied", "Zwölf
Sonnenblumen"), durchbrochen von neuen Anfällen, die auch
die Bürgerschaft von Arles intervenieren ließen,
übersiedelte er auf Veranlassung seines Bruders Theo am 8.
Mai 1889 in die Heilanstalt Saint-Paul-de-Mausole in St.
Rémy de Provence. Diagnostiziert wurde eine Form von
Epilepsie. Was zumindest die Tatsache etikettierte, dass van
Goghs Probleme nur anfallweise auftraten, mit langen
Zwischenzeiten, die allerdings gezeichnet waren durch
Alkoholmissbrauch, Überarbeitung und Fehlernährung.
sen der Erholung, in denen van Gogh einige
seiner bekanntesten Werke malte ("Ein Wiegenlied", "Zwölf
Sonnenblumen"), durchbrochen von neuen Anfällen, die auch
die Bürgerschaft von Arles intervenieren ließen,
übersiedelte er auf Veranlassung seines Bruders Theo am 8.
Mai 1889 in die Heilanstalt Saint-Paul-de-Mausole in St.
Rémy de Provence. Diagnostiziert wurde eine Form von
Epilepsie. Was zumindest die Tatsache etikettierte, dass van
Goghs Probleme nur anfallweise auftraten, mit langen
Zwischenzeiten, die allerdings gezeichnet waren durch
Alkoholmissbrauch, Überarbeitung und Fehlernährung.In St. Remy malte van Gogh die "Sternennacht". In einem weiteren Anfall versuchte er, seine Farben zu verschlucken, weshalb ihm für einige Wochen von seinem Arzt, Dr. Peyron, das Malen verboten wurde. In der Umgebung seiner Anstalt faszinierten van Gogh die Olivenhaine als malerisches Motiv. In einem Schreiben vom 29. April 1889 an den Bruder berichtet er davon: "Das Rauschen eines Olivenhains hat etwas Vertrautes, unglaublich Altes." Im gleichen Schreiben erklärt er allerdings noch "Es ist zu schön, als daß ich es malen oder auch nur daran denken könnte, es zu malen." Ab Juni entstehen dann die ersten Olivenbaumbilder van Goghs. Sie sind auch für die Forschung zum Olivenanbau von Bedeutung, insofern sie offenkundig die "plantation en/sur butte" zeigen.
Im November 1889 kritisiert er ein Ölberg-Bild Gauguins als unschön. Allgemein machten ihn "Christusse auf dem Ölberg" nach eigenem Bekenntnis wütend, da sie nicht auf Beobachtung basierten. Im Dezember 1889 malt er dann die ersten Olivenhain-Bilder mit Menschen, bei der Ernte. Auf einem seiner letzten Bilder aus St. Rémy, "Spaziergang im Mondlicht", vom Mai 1890, geht ein Paar durch einen Olivenhain - in den Farben von Goethes Werther, Blau und Gelb. Der Mann trägt deutlich Züge van Goghs, vor allem in der Gestaltung von Haupthaar und Bart und im Blick auf die Haltung. Die Frau scheint mit einem der Olivenbäume zu sprechen. Van Gogh malt die Bäume auffallend klein, fast erscheinen sie als Kinder, Kinder des Menschenpaares.
Am 16. Mai 1890 verließ van Gogh die Heilanstalt und fuhr nach Paris zu seinem Bruder Theo. Am 27. Juli schoß er sich eine Kugel in die Brust und verstarb zwei Tage später im Beisein seines Bruders. Ralph Dutli schreibt in "Liebe Olive": "Keiner konnte ihm mehr helfen, nicht einmal sein letzter Therapeut mit seinen vielen Blättern."
Beim fraglichen Öl handelte es sich um Rapsöl für technische Verwendungen, das mit Anilin denaturiert worden war und von Speiseölproduzenten, darunter die Madrider Firma Raelca, wieder für den Verkauf als Lebensmittel aufbereitet wurde. In Fünfliterflaschen boten Straßenhändlern das Öl in den ärmeren Vierteln Spaniens an. Zur fraglichen Epidemie kam es allerdings nur in einem Gebiet im Nordwesten Madrids.
Bis heute konnte kein überzeugender Nachweis zu einer Beziehung zwischen Krankheitssymptomen und gepanschtem Öl erbracht werden. Von verschiedenen spanischen Medizinern und einem epidemiologischen Experten der WHO wurden nicht das Olivenöl, sondern Phosphorsäureester, wie sie in Pestiziden für den Tomaten- und Paprikaanbau, etwa in Nemacur (Wirkstoff Fenamiphos), verwendet werden, verantwortlich gemacht.
Der Skandal führte in vielen Ländern zu Importverboten für spanisches Olivenöl - obgleich es sich bei dem umstrittenen Öl um Rapsöl handelte.
Werden bereits gärende Oliven gepresst, entsteht ein leichter Essigstich. Modernoten entstehen bei zu langer feuchter Lagerung der Oliven, ranzige Noten, wenn die Oliven zu lange am Baum hingen oder vor der Pressung warm lagerten. Gefunden wurden auch Rückstände von Weichmachern, die beim Genuss von zwei bis drei Esslöffeln Olivenöl bei einem Erwachsenen von 60 kg Gewicht bereits die Höchstgrenze für die tägliche Aufnahme überschreiten.
Die Stiftung Warentest setzte Testverfahren ein, die auch Wärmebehandlungen nachweisen können, die mit den von der EU vorgeschriebenen Tests nicht erfasst werden. Auch andere Manipulationen und Ölfehler lassen sich mit den Analyseverfahren nach EU-Verordnung nicht nachweisen. Die Olivenöllobby hat bislang erfolgreich eine Anpassung der Analysevorschriften verhindert.
2010 wiederholte "test" seine Untersuchung, mit 28 Olivenölen der Qualitätsstufe "Nativ extra" - nur vier erreichten die Note "gut". Der Rest war Durchschnitt oder mangelhaft.
Grund für die Panschereien ist zum einen der Preisdruck im Supermarkt. Ein akzeptables "Nativ extra" ist für vier Euro pro Liter eben nicht zu produzieren. Allerdings macht der Preis alleine gewiss nicht die Qualität. Auch Öle über zehn Euro für den Liter können gepanschte Fehlware sein - der Grund: besonders skrupellose Profitgier. Der dritte Grund für die Extra-Vergine-Malaisse ist die Nachfrage. Als die Deutschen (und bei anderen Nationen lief es ähnlich) lernten, das nur (mindestens) "Nativ extra" oder, italienisch, "Extra vergine" oder, deutsch, "Kalt gepresst" was Gutes für den gesundheits- und genussbewussten Kenner ist, verschwand die Kategorie "Nativ" aus den Regalen. Und kehrte unter den Fittichen von "Nativ extra", entsprechend aufbereitet, wieder.
Aber auch ohne ungesetzliche Panscherei darf das Olivenöl schlecht sein. Die EU-Verordnung 61/2011 gestattet einen Alkylesther-Anteil von 75 bzw. 150 mg/kg in "Extra Vergine". Damit kann auch durch Wärmebehandlung "verbessertes" Olivenöl getrost passieren.
Der europäische Rechnungshof kritisierte 2000 die weiter anhaltende ungeheure Verschwendung von Geldern in der Förderung des Olivenanbaus. 4,3 Milliarden Euro flossen 1999 an die Olivenanbauer, 30% der Einnahmen von Olivenbauern stamme aus EU-Geldern. Ein "erschreckenden Szenario von Betrug und Unregelmäßigkeiten zu Lasten des EU-Haushaltes" wurde festgestellt. Immer häufiger seien organisierte Kriminelle für Subventionsbetrügereien verantwortlich. Dabei seien auch die Kleinbauern am Betrugssystem lukrativ beteiligt.
Ein "Spiegel"-Titel vom September 2001 prangert die Verschwendung unter dem Titel "Großer Batzen" an. Er geht dabei zunächst auf das lukrative Geschäft mit alten Olivenbäumen ein, die als Villendekoration ausgebuddelt und verscherbelt werden. Und dabei sind laut Spiegel nicht nur böse Geschäftsleute, sondern auch Landwirte/Bauern beteiligt. In den Vordergrund stellt der Spiegel-Beitrag jedoch den Schaden für die Umwelt durch Monokulturen, die mit der in den Anbauländern besonders wertvollen Ressource Wasser und der besonders empfindlichen Ressource Boden verheerend umgehen. Und er kritisiert dabei massiv die EU: "Die Agrarpolitik der Gemeinschaft belohnt den Intensiveinsatz von Wasser und Chemikalien mit üppigen Subventionen und bestraft den traditionellen, umweltfreundlichen Olivenanbau."
2013 und 2014 hatte Spanien wegen Trockenheit mit massiven Ertragseinbußen im Olivenanbau zu kämpfen. Schuld daran ist selbstredend der Klimawandel. Und nicht, wie es auf der Hand liegt, die Umstellung auf intensiv bewässerte Olivenanlagen mit jungen, nicht tief verwurzelten Bäumen wenig trockenheitsresistenter, ertragreicher Sorten. Dazu kommt die Ableitung von Wasser aus den hügeligen Olivenanbaugebieten in die Gemüsefarmen der Ebene. Die Steuerzahler der EU werden auch die Trockenheitsschäden bezahlen, wie sie schon den ökologisch katastrophalen Umbau der historisch gewachsenen Olivenhaine und den wiederkehrenden Subventionsbetrug bezahlt haben.
"La Reppublica" nannte auch den Grund für diese Manipulationen der "agromafia". Während die Produktion von einem Liter Olivenöl in Tunesien 10 Cent koste und in Spanien 50 Cent, verlangten die Ölmühlen in der Toskana 7 Euro für den Liter! Die Verdienstspanne durch Falschetikettierung kann sich jeder selbst ausrechnen. Fünf Milliarden Euro, so "La Reppublica", setze der italienische Olivenölhandel im Jahr um. Und dies nicht nur mit herkunftsbezogen falsch etikettiertem, sondern oft auch qualitativ minderwertigem Öl, das als extra vergine verkauft werde, aber nicht einmal vergine sei. Etwa 80% des Öls der Kategorie "Extra vergine" sei falsch oder irreführend deklariert. Sofern vorhanden, seien Herkunftsangaben wie "miscele di oli di oliva comunitari e non comunitari" oft so winzig angebracht, dass sie auf Anhieb nicht zu erkennen sind.
Im März 2012 legte der italienische Bauernverband "Coldiretti" genauere Zahlen vor. 2011 habe die Einfuhr von ausländischem Olivenöl nach Italien 584.000 Tonnen betragen, die Produktionsmenge in Italien 483.000 Tonnen. 74% des Imports kamen aus Spanien, 15% aus Griechenland und 7% aus Tunesien. Nebenbei alles Exportländer, die schon das römische Reich belieferten. Die italienische Ausfuhr betrug 364.000 Tonnen.
Auch hier spielt die explodierende Nachfrage eine bedeutende Rolle. Gilt doch italienisches Olivenöl (sofern es sich wirklich um solches handelt, auch zu Recht) als geschmacklich besonders interessant und qualitätsvoll. Die Binnennachfrage für "Extra vergine" liege alleine in Italien bei 600.000 Tonnen - schreibt die Süddeutsche am 21. Oktober 2012.
Trotz der erfolgreichen Aufdeckung zahlreicher Skandale antwortet Markus Fischer, Leiter der Hamburg School of Food Science, noch 2021 auf die Frage des Magazins "forschungsfelder" nach den am häufigsten gefälschten Lebensmitteln: "Olivenöl steht an erster Stelle. Auf den Flaschen steht eine falsche Güteklasse oder sie enthalten Olivenöl, gepanscht mit billigerem Öl."
Beflügelt durch das breite Versagen der EU-Verordnungen zur Qualitätskontrolle bei Olivenölen und den Kenner-Kult im Umkreis von Slow Food und neuer Feinschmecker-Bewegung erlebte in den vergangenen Jahren die Sensorik ihre Renaissance als Diagnoseinstrument zur Bestimmung der Qualität von Olivenölen. So manche gerötete Nase senkt sich seither bei Olivenölverkostungen mit gleicher Inbrunst in Ölschälchen wie zuvor in Rotweinkelche. Und dafür gibt es durchaus auch gute Gründe!
2012 ließ das Magazin WISO des ZDF 2012 Olivenöle "in einem gängigen Testverfahren" untersuchen, das lediglich sensorische Parameter zugrunde legte - im Klartext: Aussehen, Konsistenz, Geschmack. Die WISO-Untersuchung wurde durchgeführt vom Deutschen Olivenöl Panel, hinter dem die "Informationsgemeinschaft Olivenöl" steht, die von einer Werbeagentur betrieben wird, die wiederum dem Vorsitzenden des Deutschen Olivenöl Panels, Dieter G. Oberg, gehört.
Sensorikprüfungen haben den Vorteil, billiger zu sein als die gängigen Analyseverfahren und mehr Arbeitskräfte zu erfordern, weniger Apparateeinsatz. Zudem können geübte Prüfer Mängel bzw. Qualitäten feststellen, die sich einer technischen Analyse entziehen. Allerdings wird dies nur im Hochpreissegment ernsthaft relevant. Und leider gilt anders herum auch, dass gut verborgene Mängel der Sensorik-Prüfung entgehen, dem Blick der chemischen Analyse nicht.
Es ist inzwischen allgemein bekannt, dass die geschmacklichen Eigenschaften von Olivenölen sich durch verschiedene Verfahren, die den Qualitätskriterien nicht entsprechen, erheblich verbessern lassen - etwa durch Erhitzen. Solche Manipulationen hinterlassen zwar auch Spuren im Aroma (in erster Linie durch Abwesenheit eines solchen), die aber durch Verschnitte z.B. zu kaschieren sind. Auch Schadstoffrückstände werden von Verkostern in der Regel nicht erkannt.
Die laborkritischen Anhänger der Sensorik weisen auch gerne darauf hin, dass Bio-Öl ein Schwindel sei, da auch in konventionellen Olivenhainen keine Pestizide eingesetzt würden und Schadstoffeinträge einer nahe gelegenen Autobahn auch einen Biohain träfen. Bei chemischen Analysen wurden immer wieder in einzelnen Bioölen Schadstoffe festgestellt. In der Regel konnten sie auf den Verarbeitungsprozess (wie z.B. Abfüllschläuche) zurückgeführt werden.
2014 wurden 30% Unternehmensanteile von DeOleo, dem größten spanischen Abfüller mit zahlreichen inkorporierten italienischen Marken (u.a. Sasso und Bertolli), verkauft. Ein italienisches Konsortium bot mit staatlicher Unterstützung mit und wollte den DeOleo-Unternehmenssitz nach Italien verlegen, zum Unwille der spanischen Regierung. Den Zuschlag bekam dann eine amerikanisch-französische Beteiligungsgesellschaft, CVC Capital Partners, der Firmensitz blieb in Spanien. CEO ist ein Italiener, Präsidentin eine Spanierin (Stand 2018).
2016 verbanden sich die beiden Konkurrenten in der gemeinsamen Front gegen Tunesien, als die EU-Kommission zur Unterstützung der tunesischen Demokratie eine Erhöhung der zollfreien Einfuhr von tunesischem Olivenöl forderte - die dann auch gegen den Widerstand dieser beiden Länder und Griechenlands durchgesetzt wurde für zwei Jahre.
Im Westjordanland spielen Olivenhaine eine historisch verankerte essentielle Rolle im Bereich der Subsistenzwirtschaft, aber auch des Erwerbs. Diese Olivenhaine dokumentieren die kultivierende historische Präsenz der Palästinenser in diesem Gebiet, die von nationalistischen Israeli häufig abgestritten wird. Die Region gehört zu den ältesten Olivenanbaugebieten der Welt, manche vermuten hier gar den Beginn der Olivenzucht.
Im Konflikt wurden immer wieder palästinensische Olivenhaine zerstört bei militärisch unterstützten Aktionen der israelischen Politik (etwa beim Grenzanlagenbau) und bei Angriffen nationalistischer Siedler. Es wird auch berichtet, dass israelische Siedler und bisweilen Soldaten die palästinensischen Olivenbauern bei der Ernte in siedlungsnahen Gebieten oder Grenznähe behindern, weshalb verschiedene Friedensinitiativen internationale Ernteeinsätze organisieren. Für manche Haine wird die Bewirtschaftung durch Umlenkung der Wasserversorgung oder die Landschaftsnutzung durch Neusiedler erschwert oder unmöglich gemacht.
Vor diesem Hintergrund erscheint es als zynisch, dass die Türkei ihre Offensive im Kanton Afrin Anfang 2018 "Operation Olivenzweig" nannte. Von kurdischen Demonstranten wurde dies umgewendet, indem bei Demonstrationen gegen die türkische Offensive Olivenzweige geschwenkt wurden - so auch in Kiel am 04. Februar 2018 und in anderen deutschen Städten. Die Operation der Türkei wurde von der syrischen FSA begleitet. Sie endete im März 2018, mit der Konsolidierung der türkischen Präsenz in Afrin. Bei der Operation starben nach Angaben der Türkei 897 Kämpfer der kurdischen YPG, der PYD und des IS.
Seither schwelt der Konflikt. Die Rückkehr kurdischer Zivilisten in die Region Afrin wird unter anderem behindert durch nationalistische syrisch-türkische FSA-Milizen, insbesondere in Afrin selbst. Die Olivenhaine der Umgebung werden teilweise von den Besitzern wieder bewirtschaftet.
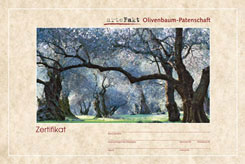 nutzt.
nutzt. Die Wilstedter und einige weitere Oliven-Enthusiasten haben inzwischen auf Kreta und in Apulien historisch und ökologisch wertvolle Olivenhaine und eine Olivenmühle erworben, die über Patenschaften und Spenden unterstützt werden können. Darüber hinaus wird "arteFakt" zunehmen im sozial-politischen Bereich aktiv, etwa mit einer "Wirtschaftshilfe von unten" für Griechenland. 2011 hat Conrad Bölicke die "Zukunftswerkstatt" eröffnet, um den Fortbestand der Firma auch nach seinem Ausscheiden zu ermöglichen. Dies ist gelungen (Stand 2017), auch wenn die Preise, wie insgesamt beim Olivenöl, davongaloppieren - was unter anderem an steigender Nachfrage und schlechten Ernten liegt.
Angetan hat es mir auch ein frühes Motto der Firma: "Landeplätze für Geistwesen schaffen". Dies spielt auf eine Sentenz Hermann Brochs an, nicht auf Ufos oder Geistererscheinungen. Ich sehe darin die Aufforderung an jeden von uns, in seinem Umfeld dafür zu sorgen, dass Engel, Elfen, Nymphen und ähnliche Wesen auf dieser Welt existieren könnten, wenn es sie denn gäbe. Was etwa gleichbedeutend ist mit: Eine Welt schaffen, in der Kinder gut gedeihen können. Nur dass die Sentenz von Broch weniger nach einer politischen Sonntagsrede klingt und zudem das Missverständnis ausschließt, damit sei Disneyland gemeint.

Die Inspiration für sein Projekt bekam Bauder zunächst in der Provence, wo er lange lebte. Nach seinem Rückzug von der Arbeit als Manager bei BASF India lernte er im Himachal Pradesh, einer Nepal benachbarten Region im Norden Indiens, ein italienisches Olivenprojekt kennen, das ihm als Vorbild für sein eigenes Projekt diente. Auch Bauder hatte mit einem Klima zu tun, das Oliven nicht von vornherein günstig ist. Doch er setzte darauf, dass gerade durch die Besonderheiten des Klimas, aber auch der geografischen Lage und der Bodenbeschaffenheit, ein interessantes Olivenöl entstehe.
Die Olivenhaine, insgesamt etwa 10 Hektar, liegen auf einer Höhe zwischen 1700 und 2000 Meter im Chitlang Valley, 100 Straßenkilometer von Kathmandu entfernt. 1994 wurde mit einer Investitionssumme von 240 000 US-Dollar begonnen. Die ersten Bäume aus provenzalischer und toskanischer Herkunft wurden 1996 gepflanzt. Allerdings machten Pilzerkrankungen vor allem im Monsunregen den nepalesischen Olivenbäumen zu schaffen. Mit der Unterstützung des israelischen Landwirtschaftsexperten Gideon Peleg, technischer Leiter eines Olivenprojektes in Rajasthan/Indien, ist es gelungen, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Peleg hat das Schnittregime, die Bewässerungstechnik und die Düngung geändert. 2010 konnte das erste Öl von 2000 Olivenbäumen verkauft werden und für 2012 erwartete Bauder erstmals schwarze Zahlen in der Buchhaltung seines Projektes. Die letzten Nachrichten zum Bauder-Projekt, die das Internet kundtut, stammen von 2012. Die mir bekannte Website des Projektes ist nicht mehr zugänglich, ebenso die mir bekannte Mailadresse (Stand Anfang 2018). Wie es aussieht, sind die Bauders nun vorrangig in ihr zweites Projekt involviert, die 1998 gestartete Zucht von Alpacas in Godavari und die Produktion von Decken aus ihrer Wolle.
 Einrichtung
von "Einkommen erzielenden Projekten", um Hilfe für
Waisenkinder, in der Regel Aids-Waisen, langfristig und
nachhaltig zu ermöglichen.
Einrichtung
von "Einkommen erzielenden Projekten", um Hilfe für
Waisenkinder, in der Regel Aids-Waisen, langfristig und
nachhaltig zu ermöglichen.Startpunkt war die Gemeinde Okakarara mit 8.500 Einwohnern, von denen etwa die Hälfte unter 18 Jahre alt ist, mit einem extrem hohen Anteil an Waisen. Für Okakarara entwickelten Hoppe mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen das Konzept für ein Kinderdorf mit Schule und verschiedenen Einrichtungen wie Internetcafé, Fahrradwerkstatt und Gemüsegärtnerei. Das geschah in enger Abstimmung mit der offiziellen Gemeindeverwaltung und den informellen traditionellen Häuptern der Gemeinschaft. Beraten wurde Hoppe auch durch erfahrene Projektträger, die in der Region aktiv waren.
Von den traditionellen Chiefs wurde das Projekt von Hoppe und seinen Mitstreitern gebilligt mit dem Satz: „Wir heißen dich und dein Projekt in Okakarara willkommen. Der Abdruck, den dein Fuß hier im Sand hinterlässt, wird niemals vom Winde verweht." 2011 wurde "Steps for Children" im Rahmen der Initiative "Deutschland. Land der Ideen" ausgezeichnet.
Inzwischen umfasst das Projekt elf "steps", von denen einige Einkommen erzielen, von denen auch die übrigen, wie die Schule, die kein Einkommen erzielt, unterstützt werden. Das für die langfristige Finanzierung wichtigste Teilprojekt ist ein Olivenhain, der Anfang 2009 auf etwa 10 Hektar mit 1664 Jungpflanzen aufgebaut wurde. 2010/11 kam es bedauerlicherweise zu erheblichen Problemen mit Frost und Ameisen. Danach wurden 416 Bäume neu gepflanzt, die nun mit Tropfbewässerung gepflegt werden. Die Überlebenden der ersten Pflanzrunde werden in Töpfen weiter kultiviert. Für neue Pflanzungen gibt es ein Patenschaftsmodell "Virtueller Olivenhain".
2016 wurde in Hamburg, veranstaltet durch den Rotarier Club Hamburg-Haake, und in Okakara das zehnjährige Jubiläum gefeiert.
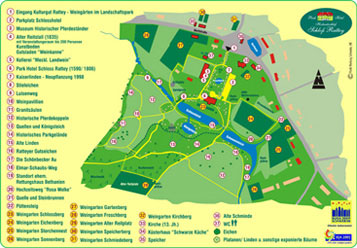 Olivenhain-Traum
durch die Pflanzung von Ölweiden im Außenbereich und Oliven
im Wintergarten erfüllt. Mit viel Enthusiasmus, Finanzkraft
und kundiger Unterstützung ist es Förster seit dem Kauf von
Schloss und Gelände 1996 gelungen, einen vielfältigen
Paradiesgarten zu schaffen, unter den spezifischen
Mecklenburger Klimaverhältnissen, die durch Ostseenähe
geprägt sind.
Olivenhain-Traum
durch die Pflanzung von Ölweiden im Außenbereich und Oliven
im Wintergarten erfüllt. Mit viel Enthusiasmus, Finanzkraft
und kundiger Unterstützung ist es Förster seit dem Kauf von
Schloss und Gelände 1996 gelungen, einen vielfältigen
Paradiesgarten zu schaffen, unter den spezifischen
Mecklenburger Klimaverhältnissen, die durch Ostseenähe
geprägt sind.Dass ihn nicht nur Oliven begeistern, sondern auch der Weinbau, macht Försters Projekt für mich doppelt interessant. Er war es, der ab 1999 den Mecklenburger Landwein gegen alle bürokratischen Hindernisse wiederbelebt und durchgesetzt hat, mit amtlichem Siegel von 2009. Damit hat er das nördlichste Weinbaugebiet in Deutschland neu begründet. Chapeau! Auf zunächst 3,7 Hektar gediehen die Rotweinsorte Regent und die Weißweinsorten Phönix, Ortega, Müller-Thurgau sowie Huxelrebe. Die Sortenwahl lässt erkennen, dass Förster und sein Winzer Stefan Schmidt auch ökologische Aspekte wie geringen Spritzmitteleinsatz im Blick hatten. 2019 gab es einen Besitzerwechsel auf Schloss Rattey, es gehört nun der "Inselmühle Usedom" GmbH. Stand 2021 ist die Anbaufläche für Wein auf 20 Hektar angewachsen.
Mecklenburg-Vorpommern genießt historisch einen guten Ruf als Region mit einem besonderen Faible für den Gartenbau. Berühmt sind etwa die Schloßgärten und Parks von Ludwigslust, Schwerin und Neustrelitz. Rattey setzt in dieser anregenden Umgebung einen zeitgemäßen neuen Akzent. Der Ruf des von Förster wiederbelebten Mecklenburger Landweins wurde bereits im Hochmittelalter begründet, durch die Zisterzienser (die sich in anderen Regionen auch für den Olivenanbau einsetzten). Die Nähe zur Ostsee schafft in Mecklenburg-Vorpommern ein maritim beeinflusstes, vergleichsweise mildes Klima, das solche Vorhaben begünstigt. Die Region beheimatet auch einige der ältesten Maulbeerbäume Deutschlands, so ein etwa 300 Jahre altes Exemplar in Grambow, das den alten Fritz noch persönlich kannte, den Förderer der Seidenraupenzucht in Preußen - eingeführt hatte diese sein Vater Friedrich Wilhelm I. bereits 1663.
Für das Jahr 1709 sind Maulbeerbäume (neben Weinstöcken, Nussbäumen und Pfirsichbäumen) dokumentiert als Opfer des großen Frostes, von welchem Bernhard Ludwig Bekmann als Herausgeber der "Historischen Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg" berichtet. Sie hätten danach aber wieder ausgetrieben.
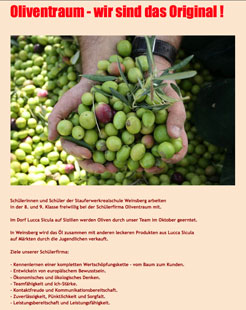 ülerfirma
"Oliventraum" nennt als eine ihrer zentralen Leistungen:
"Verbindet Menschen". Und in der Tat leistet das
Bildungsprojekt der Stauferwerkrealschule Weinsberg dies,
indem sie Menschen in Deutschland und Italien in einem
Arbeitsprojekt zusammenbringt. Und sie leistet noch weit
mehr.
ülerfirma
"Oliventraum" nennt als eine ihrer zentralen Leistungen:
"Verbindet Menschen". Und in der Tat leistet das
Bildungsprojekt der Stauferwerkrealschule Weinsberg dies,
indem sie Menschen in Deutschland und Italien in einem
Arbeitsprojekt zusammenbringt. Und sie leistet noch weit
mehr. Das Projekt wurde 2006 auf der Basis persönlicher Kontakte durch eine engagierte Lehrerin initiiert, in Kooperation mit der landwirtschaftlich geprägten Gemeinde Lucca Sicula auf Sizilien, in der Provinz Agrigent - 1.500 Kilometer von Weinsberg entfernt. Bald reisten jedes Jahr im Oktober zwölf Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klasse nach Lucca Sicula, um bei der Olivenernte mit Olivenrechen und bei der Ölpressung vor Ort selbst mit dabei zu sein und zuzupacken. Zuhause erarbeiten sie das Marketing für "ihr" Olivenöl und standen regelmäßig auf Märkten in Weinsberg und Umgebung mit diesem Olivenöl und anderen Produkten aus Lucca Sicula wie Orangenmarmelade und Honig. Dass sie dabei gerne von ihren Erfahrungen in Sizilien berichteten, versteht sich von selbst. Verbunden war mit dem Projekt, dass die jeweils neuen Teilnehmer aus der 8. Klasse von denen der schon erfahrenen 9. Klasse gleichsam "ausgebildet" wurden. So hat das Projekt auch innerhalb der Schule für neue Kontakte gesorgt.
Neben konkreten Erfahrungen mit einer kompletten Wertschöpfungskette vom Olivenbaum bis zum Endverbraucher stand auch der Erwerb von Kompetenzen wie Teamfähigkeit, kulturelle Offenheit, europäisches Bewußtsein, ökologisches und ökonomisches Denken sowie Leistungsbereitschaft auf dem Lehrplan der Schülerfirma. Mit den Erlösen aus dem Projekt unterstützte "Oliventraum" unter anderem die Arbeit des "Schüler-Cafés" der eigenen Schule. Man möchte dem Projekt viele Nachahmer wünschen - niemand sollte sich durch den Marketing-Spruch "Wir sind das Original" abschrecken lassen.
Seit Dezember 2017 ist das Schulprojekt eingestellt. Die nicht schulbezogenen Aspekte des Projektes werden von der Kooperation "Carretu Sicilianu" fortgeführt.
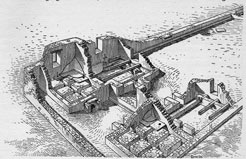 Hannibals Zug über die
Alpen im Oktober ist auch vor diesem Hintergrund zu
verstehen.
Hannibals Zug über die
Alpen im Oktober ist auch vor diesem Hintergrund zu
verstehen."Une production d'huile en Belgique et en Germanie?", fragt Jean-Pierre Brun in seinem Werk "Archéologie du vin et de l'huile en Gaule romaine" 2005. Allerdings vertieft er das Thema dann nicht in Richtung Olivenöl, er begnügt sich mit einem Hinweis auf Nussöl. Es gibt in historischen Dokumenten keinerlei Hinweise auf Olivenhaine an der Mosel, während zu den Moselweinbergen der Römerzeit zahlreiche verwaltungstechnische, literarische und archäologische Belege existieren. Beachtet werden muss allerdings, dass es in Germanien im römerzeitlichen Klimaoptimum (Augustuszeit bis ins 4. nachchristliche Jahrhundert) zwar vermutlich noch wärmer war als heute unter den Zeichen der Klimaerwärmung - aber auch sehr regnerisch, was Olivenbäumen nicht gut bekommt.
Die Benediktinerin Hildegard von Bingen empfahl im 12. Jahrhundert Olivenöl und Tee aus Olivenblättern als Heilmittel - was die Vermutung nahelegt, dass sie diese Blätter auch unmittelbar in ihrem Kloster Rupertsberg zur Verfügung hatte. Ein Zisterziensermönch aus Maulbronn titulierte sie in einem Brief als "prächtiger Olivenbaum" - ein Bild, das gelegentlich für Christus verwendet wurde. Historische Olivenbäume im Bereich des Rupertsberg-Klosters dürften allerdings kaum mehr zu belegen sein, da der Klosterbereich für die Nahetalbahn 1857 tiefgründig umgestaltet wurde.
Gesichert ist, dass Benediktinermönche erheblich daran beteiligt waren, den Olivenanbau während des mittelalterlichen Klimaoptimums in Südfrankreich und Norditalien erneut einzuführen. Die zahlreichen Kontakte der Äbtissin vom Rupertsberg in diese Regionen sind bekannt.
Grundsätzlich ist es sehr schwierig, die Dokumente des Mittelalters im Blick auf genützte Kulturpflanzen zuverlässig zu deuten. Malerei und Schrifttum (etwa die Schriften zur Heilkunde von Hildegard oder die Schrift zum Gartenbau von Strabo) waren stark durch antike Vorbilder und symbolische Konventionen geprägt. Zudem war der Handel mit exotischen Gewürzen, Gemüsesorten und Obstsorten breit aufgestellt. So ist es bislang auch unklar, ob die im Stauferreich im Rheingebiet häufig als Speise aufgeführte Feige nur aus dem Import oder auch aus eigenem Anbau stammte.
Angesichts der Klimadaten der Zeit könnte ein solcher Versuch eher Ende der 30er Jahre stattgefunden haben - nach einer Serie vergleichsweise milder Winter seit dem Winter von 1934/35 und unter den Rahmenbedingungen nationalsozialistischer Autarkievorstellungen. Eventuell a
 uch im unmittelbaren Gefolge des
Hitler-Mussolini-Paktes vom Mai 1939. Mit dem Winter 1939/40
begann eine Folge sehr strenger Winter in der Region, die
Olivenbäume, zumal unter Kriegsbedingungen, sicherlich nicht
überstehen konnten.
uch im unmittelbaren Gefolge des
Hitler-Mussolini-Paktes vom Mai 1939. Mit dem Winter 1939/40
begann eine Folge sehr strenger Winter in der Region, die
Olivenbäume, zumal unter Kriegsbedingungen, sicherlich nicht
überstehen konnten.In den 90er Jahren kam durch Mario Strähler, der lange Jahre in Rom gelebt hatte, die Palmen-Leidenschaft nach Deutschland. Nachdem in Deutschland schon in den Jahren des Wirtschaftswunders Palmen in die Wohnzimmer eingewandert waren, eroberten sie nun, gemeinsam mit Bananenstauden, den Außenbereich von Gärtnern mit Südwind-Sehnsucht.
In unmittelbarer Nähe zu Neustadt pflanzte der Winzer und Botaniker Peter Straub 1999 und in den Folgejahren Oliven in seinen Projekten "Mediterraner Garten" (Maikammer) und "Biblischer Garten" (St. Martin). Gut entwickelten sich die Bäume in St. Martin, im Schutz einer Sandsteinmauer unterhalb der Patronatskirche von St. Martin. Im Herbst 2018 konnte ich dort auch reife Früchte bewundern (s. Foto)! In Maikammer steht, gleichfalls im innerörtlichen Bereich, lediglich ein vitaler Busch, der 2018 keine Früchte trug. Im Südfrüchtegarten Rhodt gibt es keine Oliven, aber sehr schöne Exemplare von Ziziphus jujuba, der chinesischen Dattel.
Auch in den Folgejahren schaute ich immer wieder mal bei den Oliven von St. Martin vorbei. Dank Bewässerung können sich dort üppig Früchte entwickeln - aber kaum jemand nimmt die etwas versteckt platzierten Bäume wahr. Interessant sind im Biblischen Garten von St. Martin auch die Erdbeerbäume und andere Exoten.
Bitte melden Sie sich, wenn Sie zum historischen Neustädter Olivenhain oder anderen Olivenhainen in Deutschland vor 2005 Informationen haben!
Die Bäume in Pulheim-Stommeln stammten teilweise aus der Olivenbaumsammlung Marzaks, der bereits Anfang der 90er Jahre über sein Unternehmen sortenechte Olivenbäume in Deutschland verkaufte. 2006 und 2007 fanden auf dem Gelände der Baumschule "Olivenblütenfeste" statt und Anfang 2008 konnte schon die erste Ernte von 25 Kilogramm vermarktet werden. Der Bestand umfasste 2007/08 ca. 110 Bäume auf 1000 qm - wobei 45 Bäume neu gepflanzt waren, also noch nicht nennenswert fruchten konnten. Im Frühjahr 2008 trennten sich die Partner und die Brüder Becker betrieben dann mit einem Teil des Bestandes und Neupflanzungen den Hain alleine weiter.
Diesem Olivenhain verdanke ich meine erste Begegnung mit jungen, ausgepflanzten Olivenbäumen in Deutschland - zunächst im Internet, dann draußen im Leben. Am 9. Mai 2008 besuchte ich den Hain und Michael Becker erklärte mir die Pflegeprinzipien. Im Kofferraum nahm ich 8 Leccino und 8 Olivastra Seggianese als "Heister" (Pflanzbäume) zurück mit nach Obergrombach. Beides in der Toskana heimische Sorten, die sich in Pulheim schon bewährt hatten - und dann auch bei mir bewährten, mit der Einschränkung, dass auch diese Sorten mit den Wintern 2008/09 bis 2011/12
 nicht
ohne massive Schutzmaßnahmen klar kamen und im Frostfebruar
2012 bis auf je zwei Exemplare verloren gingen.
nicht
ohne massive Schutzmaßnahmen klar kamen und im Frostfebruar
2012 bis auf je zwei Exemplare verloren gingen.Der Winter 2008/2009 hat dem Pulheimer Hain sehr zugesetzt. Obgleich etwa dreißig Bäume der Sorten Leccino und Olivastra Seggianese nach Auskunft der Beckers noch Vitalität zeigten, haben sie beschlossen, am 8. Mai 2009 einen radikalen Neuanfang zu starten - ausschließlich mit Jungbäumen dieser Sorten. Dafür gibt es gute Gründe. Nach dem Katastrophenwinter 1984/85 hat sich in der Toskana gezeigt, dass Neupflanzungen innerhalb weniger Jahre frostgeschädigte Altanlagen im Ertrag überholen konnten. Das Bild
 links
zeigt die Neuanlage mit Beachball-Feld Anfang Mai 2009 - bei
meinem zweiten Besuch aufgenommen, als ich mich davon
überzeugen musste, dass vom einst wundervollen Altbestand
nichts mehr stand!
links
zeigt die Neuanlage mit Beachball-Feld Anfang Mai 2009 - bei
meinem zweiten Besuch aufgenommen, als ich mich davon
überzeugen musste, dass vom einst wundervollen Altbestand
nichts mehr stand!Nach dem wiederum sehr strengen Winter 2009/10 wurde mit Leccino neu angepflanzt, dazu kamen als Befruchter einige Cipressinos. 2016 gab es, so berichtete mir Michael Becker bei meinem dritten Besuch 2017, eine Ernte von 70 Kilogramm. Bei einem weiteren Besuch im August 2019 konnte ich mich davon überzeugen, dass dieser Hain keinen Vergleich mit jungen Hainen in Italien scheuen muss, auch nicht in seinem respektablen Fruchtbehang - siehe Bild rechts! Lediglich die Cipressinos waren vom Winter 2016/17 in Mitleidenschaft gezogen worden. Was bei dieser Sorte nicht erstaunt. Mit beispiellosem Einsatz haben die Beckers es also geschafft, einen fruchtenden Olivenhain in Deutschland zu etablieren - falls meine Klima-Zyklusprognosen stimmen, dürfte sich dieser Hain halten zumindest bis ca. 2040.
 La
Cava" in Köln-Widdersdorf - darunter die ältesten in
Deutschland aus italienischem Pflanzgut groß gewordenen
Olivenbäume. Der Hain stand auf einem Gelände von etwa 2000
qm und zählte 2008 etwa 180 Bäume.
La
Cava" in Köln-Widdersdorf - darunter die ältesten in
Deutschland aus italienischem Pflanzgut groß gewordenen
Olivenbäume. Der Hain stand auf einem Gelände von etwa 2000
qm und zählte 2008 etwa 180 Bäume. Nach meiner Visite bei den Beckers besuchte ich im Mai 2008 "La Cava" und fand dort mit Christian Schmitt einen engagierten Betreuer des gerade angelegten neuen Hains. Allerdings verließ er das Projekt im Jahr darauf. Bei meinem zweiten Besuch 2009 fand ich den Bestand in einem bedauernswerten Zustand wieder. Denn auch in Köln-Widdersdorf hatte der Winter 2008/09 grausame Spuren hinterlassen.
Die erfrorenen Jungbäume wurden ersetzt durch Leccino und Canino (eine als robust geltende Sorte aus Mittelitalien), ältere Bäume waren zurückgeschnitten in der Hoffnung, dass sie auch im Kronenbereich neu austreiben. Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllte. Im Vordergrund der Aufnahme vom 8. Mai 2009 sind die zurückgeschnittenen Bäume zu sehen, im Hintergrund die Neupflanzungen. Laut Pressemitteilung von "Olive e Più" vom November 2009 haben "fast alle" Überlebenden aus dem Wurzelstock wieder neu ausgetrieben. Bei den Neupflanzungen wurde Ende 2009 eine Olivenernte gefeiert. Nach dem erneut strengen Winter 2009/2010 wurde auf ein Olivenfest mit Hinweis auf die wiederholten Frostschäden verzichtet. Eine Entscheidung, die Respekt verdient!
Danach wurde das Projekt Olivenhain in Köln-Widdersdorf eingestellt. Gärtnerisch werden allerdings von La Cava weiterhin Olivenbäume unterschiedlichen Alters angeboten, darunter auch ältere Solitäre aus Spanien. Seit Oktober 2012 geschieht dies am neuen Standort in Köln-Vogelsang.
2009 gepflanzt ist der Hain nach zwei strengen Wintern komplett erfroren und so wurde er 2011 auf Initiative des Unternehmerehepaares Karin und Johannes Heinrichs im Rahmen eines auf Fortsetzung angelegten Symposions ("1. Gangelter Skulpturenwoche") teilweise in Holzskulpturen verwandelt. Der Pflanztermin lag hier extrem ungünstig, drei Jahre später gepflanzt hätte der Hain eine reele Chance gehabt!
Zehn europäische Künstler und Künstlerinnen aus sieben Ländern waren vom 01. bis 11. September 2011 auf dem Gelände der Alten Ziegelei Gangelt damit beschäftigt, aus den toten Olivenbäumen Skulpturen zu gestalten. Die Holzbildhauerin Brele Scholz aus Aachen koordinierte das Projekt künstlerisch. Sie selbst arbeitet vorwiegend mit Stammholz und hat aus einem abgestorbenen Olivenbaum ein Tango-Paar gestaltet.
Die Verkaufserlöse der Skulpturen gingen zum Teil an den Verein "Partnerschaft für Afrika", zum Bau eines Waisenhauses. Der Verein war Anfang 2011 gegründet worden, mit Johannes Heinrichs als Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzendem. Das Projekt "Gangelter Skulpturenwoche" wurde nicht fortgesetzt, Heinrichs widmete sich fortan der "Partnerschaft für Afrika", für die er auch mehrmals nach Tansania reiste, zum Aufbau und zur Betreuung des Waisenhauses, für Bildungsprojekte und zur Nothilfe bei Dürre. Leitlinie der Vereinsarbeit ist die Hilfe zur Selbsthilfe, die Geschäftsführerin Friederike Heidenhof (eine namhafte Dressurreiterin) ist seit 2005, zunächst für die Erzdiözese von Arusha, in Tansania engagiert.
Das Holz der Oliven war schon in der Antike ein begehrtes Material für Schnitzarbeiten und Skulpturen. Auch für Schüsseln, Schalen und Besteck ist es ausgezeichnet geeignet. Holz ist ein besonders vergänglicher Werkstoff, weshalb nur wenige materielle Belege zu dieser Weise der Olivennutzung in der Antike existieren. Die Verwendung als Brennholz wurde in einigen spektakulären Funden der jüngeren Zeit nachgewiesen, so (für Wildoliven) an menschlichen Feuerplätzen mit einem Alter von ca. 790.000 Jahren in Israel, durch Forscher der Bar-Ilan Universität.
Die Prognosen für d
 en
Mosel-Olivenhain waren wegen der temperaturausgleichenden
Wirkung des Flusses und dank des wärmespeichernden
"Schiefergebröckels" grundsätzlich günstig. Als Winterschutz
wurden im ersten Winter 2009/10 Stroheinhüllungen
eingesetzt. Die Wurzeln von 75% der Heister hatten, wie
berichtet wurde, diesen Winter überlebt. 2010 legte die
Familie mit dem befreundeten Biowinzer-Paar Erika Helmut
Krauss (die in dem kleinen türkischen Dorf Sirince den
Weinbau umgekrempelt haben) einen weiteren Olivenhain mit
100 Pflanzen bei Zell in der Pfalz auf Lössboden an, um, wie
der Website zu entnehmen ist, Erfahrungen auf
unterschiedlichen Böden zu sammeln. Im Winter 2010/11 wurden
die Pflanzen der beiden Haine mit Kunststoffmanschetten
geschützt. 2011 hat die Familie das Moselprojekt der
wiederholten Frostschäden wegen beendet. Vom Zeller Hain ist
nach Oktober 2011 nichts mehr zu hören/lesen. Der
Frostfebruar 2012 dürfte auch hier fatal gewirkt haben.
en
Mosel-Olivenhain waren wegen der temperaturausgleichenden
Wirkung des Flusses und dank des wärmespeichernden
"Schiefergebröckels" grundsätzlich günstig. Als Winterschutz
wurden im ersten Winter 2009/10 Stroheinhüllungen
eingesetzt. Die Wurzeln von 75% der Heister hatten, wie
berichtet wurde, diesen Winter überlebt. 2010 legte die
Familie mit dem befreundeten Biowinzer-Paar Erika Helmut
Krauss (die in dem kleinen türkischen Dorf Sirince den
Weinbau umgekrempelt haben) einen weiteren Olivenhain mit
100 Pflanzen bei Zell in der Pfalz auf Lössboden an, um, wie
der Website zu entnehmen ist, Erfahrungen auf
unterschiedlichen Böden zu sammeln. Im Winter 2010/11 wurden
die Pflanzen der beiden Haine mit Kunststoffmanschetten
geschützt. 2011 hat die Familie das Moselprojekt der
wiederholten Frostschäden wegen beendet. Vom Zeller Hain ist
nach Oktober 2011 nichts mehr zu hören/lesen. Der
Frostfebruar 2012 dürfte auch hier fatal gewirkt haben.Die ehemaligen Betreiber sind laut ihrer Website der Auffassung, dass es in 50 Jahren normal sein dürfte, an der Mosel Olivenbäume zu haben. Ich halte dies auch für möglich, wage inzwischen aber keine Prognosen mehr zur langfristigen regionalen Klimaentwicklung, unter anderem nach den Wintererfahrungen 2008/09 bis 2011/12. Ich vermute auch, dass bereits während der Römerzeit und im mittelalterlichen Klimaoptimum Olivenbäume an der Mosel standen. Sicherlich nur in geringer Zahl, da sich sonst Zeugnisse erhalten hätten. Und es gab auch wenig Anlass, größere Haine anzulegen. Die Klimabedingungen dürften trotz höherer Temperaturen nicht optimal gewesen sein und die Handelsbeziehungen zu Olivenöl produzierenden Regionen waren vollkommen ausreichend, die Nachfrage zu befriedigen - die ohnedies nur zur Römerzeit in nennenswertem Umfang bestanden haben dürfte.
Fischer hat im Spätsommer 2008 nördlich von Freiburg 90 Heister der Sorten Leccino und Frantoio in ein Ackergelände gepflanzt und im Winter ganz ohne Schutz belassen. Wie er schreibt, haben nur fünf Exemplare den Extremfrost 2008/09 nicht überlebt, was ganz erstaunlich ist - insbesondere vor dem Hintergrund, dass erst im September gepflanzt wurde. Der Betreiber hat mir Fotos vom Juli 2009 geschickt, auf denen gut Neuaustriebe zu erkennen sind. 2010 bis 2015 gab es auch eine ansprechende eigene Homepage zum "Hochdorfer Olivenhain".
Die Region um den Kaiserstuhl hat nach meiner Einschätzung besonders gute Chancen, einen stabilen Olivenhain in Deutschland zu etablieren. Denn die aktuelle Klimaentwicklung produzierte in den vergangenen Wintern eisige Troglagen von Norden her, deren Zungen bis in den Raum Heidelberg/Karlsruhe vordrangen - und mich viel Nerven gekostet haben. Südbaden bli
 eb
weitgehend verschont und die Fotos vom Hochdorfer Hain aus
dem Frühjahr 2011 sind wirklich beeindruckend. Teilweise
sind dann die Blätter abgefallen, doch das Holz hatte keine
größeren Schäden abbekommen. Fischer hatte die Pflanzen im
Winter 2010/11 durch Vlies geschützt.
eb
weitgehend verschont und die Fotos vom Hochdorfer Hain aus
dem Frühjahr 2011 sind wirklich beeindruckend. Teilweise
sind dann die Blätter abgefallen, doch das Holz hatte keine
größeren Schäden abbekommen. Fischer hatte die Pflanzen im
Winter 2010/11 durch Vlies geschützt.Der Frostfebruar 2012 erreichte allerdings auch die privilegierte Kaiserstuhlregion und schädigte die Bäume der Hochdorfer Anlage erheblich (wie es scheint, stärker als die Beckersche Anlage). Das Projekt wurde jedoch weitergeführt und 2016 kann Fischer mir neue Bilder schicken, die vitale Bäume zeigen!
Bei einem Besuch im Mai 2017 konnte ich den Zustand der Anlage persönlich bewundern: Zehn verbliebene Bäume, die in Stamm und Kronenentwicklung etwa den Beckerschen entsprechen (s. Foto). Allerdings war vom voraufgegangenen Jahr nur minimal Laub erhalten, mit starkem Occhio di Pavone-Befall. Der Neuaustrieb war überwiegend beachtlich. Aufgefallen ist mir der massive Besatz mit Gelbflechten, der Hain liegt inmitten landwirtschaftlicher Flächen, stark windexponiert.
In der Folge hat Fischer bedauerlicherweise die Pflege des Bestandes aufgegeben.
Die Journalistin Anke Petermann hat für den Deutschlandfunk im Oktober 2018 eine kurze Sendung geschnitten mit dem Titel "Oliven-Anbau in Deutschland - ein Generationen-Vorhaben". In der Anmoderation wird forsch von Deutschland als Olivenanbauland und von deutschen "Olivenbauern" gesprochen. Im Mittelpunkt des Beitrages steht eine ökologisch interessante Olivenanlage mit 25 Pflanzen oberhalb von Ahrweiler, am Domberg, betrieben von einem Olivenölhändler und einem Prädikatswinzer seit 2016, anerkannt als ökologische Ausgleichsmaßnahme. Gepflanzt wurden dort oberhalb der Ahr die Sorten Frantoio, Leccino, Moraiolo und Pendolino aus Italien, Hojiblanca und Picual aus Spanien. Leider gab es im Sommer 2018 durch Vandalismus Ärger, was die Initiatoren, Michael Kriechel und Oliver Heimermann, jedoch nicht entmutigt.
Auch dieser Hain steht (wie der ehemalige Hain von Pünderich) auf gut geeignetem "Schiefergebröckel" an einem Südhang. Frostschutzmaßnahmen werden nicht eingesetzt. Ziel ist, wie bei den Beckers in Pulheim-Stommeln, die Produktion eines eigenen Olivenöls.
Stand 2022 umfasst die Anlage etwa 40 Bäume - der trockene Sommer 2019 hat eine Neuanpflanzung erheblich beeinträchtigt. Der Fokus liegt nun auf spanischen Sorten, Picual, Hojiblanca und Arbequina. Mit diesen gebe es, so Heimermann, bislang sehr positive Erfahrungen, auch im Fruchtansatz. Mit sommerlichen Trockenheiten dürften die spanischen Sorten besonders gut zurechtkommen. 2022 wurden von den Betreibern an einem anderen Standort im Ahrtal weitere 80 Bäume dieser Sorten plus Frantoio, eine ertragsorientierte Sorte, gepflanzt.
Erklärtes Ziel seines Projektes ist es, noch in der eigenen Lebenszeit eine nennenswerte Olivenernte von eigenem Boden zu erleben. Mit jungen Neupflanzungen schien ihm dies eher aussichtslos. Sein Ziel hat er wohl erreicht, denn er konnte im November 2024 laut Medienberichten etwa 300 kg Früchte von seinen Andalusiern ernten! Da er sich auch eine eigene Olivenölpresse aus Italien hat kommen lassen, darf er den Wettbewerb um das erste rundum eigene Olivenöl aus Deutschland für sich als gewonnen betrachten - sofern man alt verpflanzte Bäume als Quelle akzeptiert. Die Beckers in Pulheim-Stommeln hatten zwar bereits 2016 eine respektable Ernte von 70 kg und 2020 eine von 200 kg aus in Deutschland groß gewordenen Bäumen berichtet, aber zum eigenen Olivenöl gibt es in den Medien und auf der Website unterschiedliche Aussagen. Unter anderem die, dass sie ihre Oliven gemeinsam mit anderen in Griechenland pressen lassen.
Auf seiner perfekt gestalteten Website erklärt Weiand, dass es ihm bei seinem Projekt wesentlich um Biodiversität, Nachhaltigkeit und einen kleinen CO2-Fußabdruck gehe. Nicht einmal Lohnarbeit wolle er bei der Pflege seines Geländes (mit Olivenhain und Weinbergen) in Anspruch nehmen. Hehre Versprechungen, deren Einlösung Interessierte selbst anhand der Fakten und vor Ort überprüfen müssen. Als Frostschutzmaßnahme setzt Weiand im Winter Folienhüllen für die Kronen seiner Olivenbäume ein.
Das Gelände wird überragt von einer ehrwürdigen Zypresse. Zusammen mit weiteren Zypressen im Umfeld gibt sie Zeugnis von weit älteren Versuchen, dem Ihringer Weinbaugebiet einen Hauch von Toskana zu verleihen. Und wer ein wenig in der Umgebung spazierengeht, der entdeckt am Hang Richtung Rasthaus Lenzenberg an einer höher gelegenen südseitigen Nische zwei etwa fünfzigjährige Olivenbäume aus dem Gartencenter, die dort schon weit länger als die Andalusier zu stehen scheinen. Denn die um einen Stamm verteilten provisorischen Frostschutzmaterialien sind teils schon zerfallen oder überwachsen. Etwas oberhalb, wo es für Oliven am optimalsten wäre, steht leider eine Hütte, in deren Nähe unlängst (Stand Januar 2025) eine dritte, junge Olive gepflanzt wurde.
Das Thema scheint aktuell (Stand 2025) sehr virulent zu sein. Nicht nur die Klimaentwicklung macht einigen Winzern zu schaffen, sondern auch die Marktentwicklung durch weiter zunehmende internationale Konkurrenz und durch zurückgehenden Weinkonsum in Deutschland. An konkreten Oliven-Projekten in Weinberganlagen ist allerdings nicht viel zu finden, neben den oben genannten 30 Heistern sind noch einige ältere Einzelpflanzungen bei verschiedenen Winzern bekannt, als Gestaltungselemente, aus Liebhaberei oder als Teil eines Experiments.
Besonders interessant ist nach meiner Einschätzung der Olivenbestand in den Hessigheimer Felsengärten, die klimatisch und in der Bodenbeschaffenheit privilegiert sind. An einem SWW-Hang im Prädikatsweingut Ruben Eisele konnte ich bei einem Besuch im September 2025 zehn prächtige Exemplare der Sorte Ascolana tenera finden, die auch schon beeindruckende Speiseoliven trugen, und fünf gleichfalls respektable Olivenbäume beim direkten Nachbarn. Weitere Versuche mit Olivenpflanzungen sind in anderen Anlagen dort zu sehen. Im Hessigheimer Weinberg des Landschaftsgärtners Marc Müller stehen, so ist zu hören, seit 2019 Oliven, Feigen und Kaki. Seine Anlage ist mir bei meinem Besuch leider nicht aufgefallen. Von den gelegentlich genannten Oliven im Weingut von Christian Seybold in Lauffen am Neckar ist auf der Website des Unternehmens nichts zu lesen, nur von Kürbissen, Palmen und Zitrusfrüchten.
Auch aus Österreich ist von Versuchen mit Oliven in Weinbergen zu hören/lesen (siehe unten). Und zur Abschattung von Reben gegen den Klimastress sowie gegen zu hohe Mostgewichte werden in Rheinland-Pfalz versuchsweise bereits Bäume zwischen die Reben gepflanzt ("Vitiforst"). An Oliven denkt man dabei nur unter ferner liefen, aus nachvollziehbaren Gründen, etwa wegen der Frostproblematik und weil es zu wenige verlässliche Erfahrungen insgesamt mit Vitiforst in Deutschland gibt.
Das Landwirtschaftliche Technologiezentrum/LTZ Augustenberg bei Karlsruhe hat 2025 mit einem Untersuchungsprojekt zum Olivenanbau begonnen, mit je fünf Exemplaren von fünf Sorten - auch auf die Nachfragen von Winzern hin.
Die Idee zum Olivenanbau wurde auf der Hochzeitsreise des Paares an der Amalfiküste 2002 geboren. 2011 starteten sie ein erstes Experiment mit zwölf Bäumen sechs verschiedener Varietäten, von denen sich die drei genannten als besonders erfolgversprechend zeigten. Im April 2012 erreichte ein Container mit 200 Oliven dieser Sorten aus Norditalien ihr neues Zuhause, Huggits Farm. Zur Vorbereitung des Geländes, einer brachliegenden Wiese beim Haus, wurde erstmal Glyphosat gespritzt. An die Anlage einer artenreichen Streuobstwiese dachte Neil Davy, von Beruf Management Consultant, nicht. Sein Ehrgeiz zielte auf die Produktion eines eigenen englischen Olivenöls und auf eine auch ökonomisch erfolgreiche Anlage. Und zunächst ließ das Projekt sich vielversprechend an. Der Frostfebruar 2012 blieb dem Hain erspart und nach einigen Schäden durch den Märzwinter 2013 konnten Ende 2013 etwa 20 Kilogramm Oliven geerntet werden, die eingelegt wurden. In der Folge habe der Hain sich gut entwickelt. Auch das Schneechaos Ende Februar/Anfang März 2018 habe er stabil überstanden - laut Facebook und Twitter.
Im Juni 2024 kann ich keine Neuigkeiten zu diesem Projekt im Internet finden. Die zugänglichen substantiellen Medienberichte stammen aus den Jahren 2012 bis 2015.
Ein anderes österreichisches Paar war schneller, aber weniger wissenschaftlich, vielmehr an Kulinarikangeboten interessiert. In Kapelln bei St. Pölten (Niederösterreich) und sukzessive dann noch in der Wachau (Weinberg in Steillage) und in Untergrafendorf haben Rosemarie Zechmeister und Franz Bräuer seit 2016 etwa 320 Olivenbäume gepflanzt (Stand 2020) auf ca. 2,2 Hektar. Über Kontakte nach Spanien haben sie sich für die Sorte Arbequina entschieden, als Befruchter kamen noch Leccino (eine italienische Sorte) und Picual (gleichfalls eine spanische Sorte) dazu. Gepflanzt wurden teilweise auch ältere Bäume. Das Projekt hat mehrere Dimensionen, dazu gehört ein historischer Vierkanthof, der "Olivenhof".
Im März 2019 hat sich noch ein Winzer in den österreichischen Olivenanbau eingeklinkt, Peter Skoff. Auf seinem Bio-Weingut in Gamlitz (Steiermark) pflanzte er zusammen mit seinen beiden Söhnen Peter und Markus 320 zweijährige Olivenbäume aus der Toskana, die im gleichen Jahr körbeweise Früchte trugen, nach einem Bericht in "Meine Woche". Aus den Folgejahren gibt es (Stand September 2025) keine weiteren Informationen in den Medien und auf der Website des Weinguts. Im April 2021 kam noch ein anderer Steiermärker dazu, Lukas Weber im Raabtal, der es nach schlechten Erfahrungen mit der Produktion von Kürbiskernöl nun mit 250 Olivenbäumen spanischer Herkunft (Hojiblanca, Picual) als Ölproduzent versuchen möchte. 2026 will er sein erstes Olivenöl pressen.
2020 wurde im österreichischen Burgenland, mit drei Hainen gleichfalls in Mörbisch, das Startup "AgroRebels" (Daniel Rössler - Soziologe, Markus Fink - Physiker, Lukas Hecke - Projektmanager) lanciert, das dem Klimawandel in Österreich mit Olivenbäumen begegnen möchte.
 dem
Foto links. Wenn man nur leicht an ihnen rieb, lief schon
üppig sehr aromatisches Öl über die Finger. Der Hain wurde
nur noch zur Beweidung durch Ziegen genutzt, der Ertrag der
vorangegangenen Jahre lag auf dem Boden verstreut. Ziegen
fressen auch leidenschaftlich gerne Olivenzweige, sofern sie
rankommen können; in manchen Bäumen steckten daher noch
alte, rostige, halbeingewachsene Eisengitter. Sie sollten
die talentierten Kletterer einst davon abhalten, in die
Kronen einzusteigen und dort zu äsen.
dem
Foto links. Wenn man nur leicht an ihnen rieb, lief schon
üppig sehr aromatisches Öl über die Finger. Der Hain wurde
nur noch zur Beweidung durch Ziegen genutzt, der Ertrag der
vorangegangenen Jahre lag auf dem Boden verstreut. Ziegen
fressen auch leidenschaftlich gerne Olivenzweige, sofern sie
rankommen können; in manchen Bäumen steckten daher noch
alte, rostige, halbeingewachsene Eisengitter. Sie sollten
die talentierten Kletterer einst davon abhalten, in die
Kronen einzusteigen und dort zu äsen. Bei einer eher hobbymäßig betriebenen Neuanlagen auf dem Gelände eines größeren Ferienhauses fielen mir junge Olivenbäume auf, die in Mulden gesetzt waren. Der Besitzer erklärte mir, dass er dies zur besseren Wasserversorgung gemacht habe. Allerdings gab es ansonsten nur sehr wenige Neuanlagen und viele vernachlässigte Altanlagen. Der Olivenanbau auf Naxos wird offensichtlich von anderen Formen der Landwirtschaft allmählich verdrängt und überwiegend in der Südhälfte der Insel noch aktiv betrieben, mit teilweise imposanten Altanlagen, die endlich durch eine geänderte EU-Subventionspolitik gefördert werden müssten. Zumal die Qualität der Naxos-Oliven bemerkenswert ist.
Naxos ist die größte und fruchtbarste Insel der Kykladen, es gibt auch einige große Ackerflächen mit Höfen, deren üppigen Fuhrparks der EU-Subventionseinfluss deutlich anzusehen ist. Überraschend für griechische Inseln ist auch der hohe Bestand an Milchkühen. Auch Ziegenherden, teilweise eng gepfercht, mit erbärmlichen Gitterzäunen und schmutzigen Barackenunterkünften, waren allenthalben zu finden und füllten entlegene Täler eines Gebietes, das einst als idyllisches Wanderparadies gepriesen wurde.
 Bei einer Reise in die
Toskana vom 17. bis 31. März 2009 besuchte ich die Azienda Sperimentale di Santa
Paolina in
Follonica, Versuchsgut des toskanischen Olivenanbaus und
weltweit anerkanntes Zentrum der Olivenforschung, mit dem
Genbestand von 140 regionalen Olivensorten! Der
ausgesprochen hilfsbereite Institutsleiter Claudio Cantini
und seine Kollegen gaben mir Tipps zur Steigerung der
Frostresistenz (ausreichende Versorgung mit Kalium), zum
Baumschnitt (s. Riccardo Gucci/Claudio Cantini: Pruning and
Training Systems for Modern Olive Growing) und zur Propfung
von Oliven. Von drei für meine Zwecke interessanten
Olivensorten (Grappolo, Bianchera, Leccio del Corno) bekam
ich Zweige mit, um daraus zuhause Pflanzen zu ziehen bzw. zu
propfen. Die Propfungen gelangen, mit Stecklingen hatte ich
keinen Erfolg.
Bei einer Reise in die
Toskana vom 17. bis 31. März 2009 besuchte ich die Azienda Sperimentale di Santa
Paolina in
Follonica, Versuchsgut des toskanischen Olivenanbaus und
weltweit anerkanntes Zentrum der Olivenforschung, mit dem
Genbestand von 140 regionalen Olivensorten! Der
ausgesprochen hilfsbereite Institutsleiter Claudio Cantini
und seine Kollegen gaben mir Tipps zur Steigerung der
Frostresistenz (ausreichende Versorgung mit Kalium), zum
Baumschnitt (s. Riccardo Gucci/Claudio Cantini: Pruning and
Training Systems for Modern Olive Growing) und zur Propfung
von Oliven. Von drei für meine Zwecke interessanten
Olivensorten (Grappolo, Bianchera, Leccio del Corno) bekam
ich Zweige mit, um daraus zuhause Pflanzen zu ziehen bzw. zu
propfen. Die Propfungen gelangen, mit Stecklingen hatte ich
keinen Erfolg.Am 21. März 2009 lernte
 ich
einen Olivenhain in der Nähe von Arezzo kennen, in
welchem zwei Sorten wachsen, Morcone und Gentile Nero
d'Anghiari/Gentile di Anghiari, die sowohl den Frostwinter
1955/56 als auch den von 1984/85 überstanden haben. Während
1956 nur der Februar mit Frösten zugeschlagen hatte, wurden
1985 in der Toskana 80% der Olivenbestände durch eine Januar
und Februar übergreifende langanhaltende Frostperiode
ruiniert. Danach wurde die Vasenerziehung als
klimaangepasste Erziehungsform propagiert.
ich
einen Olivenhain in der Nähe von Arezzo kennen, in
welchem zwei Sorten wachsen, Morcone und Gentile Nero
d'Anghiari/Gentile di Anghiari, die sowohl den Frostwinter
1955/56 als auch den von 1984/85 überstanden haben. Während
1956 nur der Februar mit Frösten zugeschlagen hatte, wurden
1985 in der Toskana 80% der Olivenbestände durch eine Januar
und Februar übergreifende langanhaltende Frostperiode
ruiniert. Danach wurde die Vasenerziehung als
klimaangepasste Erziehungsform propagiert.Olivenbauer Virgilio Ciceroni, eine beeindruckende Persönlichkeit, manövrierte mich in seinem unverwüstlichen Lada Niva durch die Hügel bei Molin Nuovo und zeigte mir, wie die ertragsorientierte Sorte Frantoio nach dem Extremfrost von Anfang 1985 neu aus den Wurzeln austreiben musste, während die Sorten Morcone und Gentile Nero d'Anghiari mit dem Austrieb von 1956 oder dem noch älteren Stamm überlebten. Ciceroni hat nun im Alter eine Leidenschaft für jene traditionellen Olivensorten entwickelt, die einst von seiner Generation durch ertragreichere Sorten ersetzt worden waren.
An diesem Tag (Frühlingsanfang!) schneite es im Olivenhain - und die Außentemperaturen sind an Ciceronis Kleidung abzulesen!
In Cosimo Trinci
 s "L'agricoltore
sperimentato" von 1763 fand ich beeindruckende
Beschreibungen von extremen Frostereignissen seit 1216, die
den Olivenbestand der Region regelmäßig vernichtet haben.
Und Giovanni Presta, ein kluger und noch heute gelesener
Mediziner und Agronom des 18. Jahrhunderts, schreibt in
"Degli ulivi, delle ulive e della maniera di cavar l'olio"
von Olivenanbauländern, in welchen das Thermometer im Winter
häufig bis -8 oder gar -10 Grad sinke (anzumerken ist:
geschrieben zur Zeit der "kleinen Eiszeit").
s "L'agricoltore
sperimentato" von 1763 fand ich beeindruckende
Beschreibungen von extremen Frostereignissen seit 1216, die
den Olivenbestand der Region regelmäßig vernichtet haben.
Und Giovanni Presta, ein kluger und noch heute gelesener
Mediziner und Agronom des 18. Jahrhunderts, schreibt in
"Degli ulivi, delle ulive e della maniera di cavar l'olio"
von Olivenanbauländern, in welchen das Thermometer im Winter
häufig bis -8 oder gar -10 Grad sinke (anzumerken ist:
geschrieben zur Zeit der "kleinen Eiszeit"). Bei Presta entdeckte ich zu Griechenland den bemerkenswerten Satz "ha l'inverno siccome l'ha la Germania" - und zwar "a motivo dei frequenti ed altissimi nevosi monti e delle vaste e profonde valli". Eine Aussage, die in der Tendenz durchaus auch für Teile der nördlichen Toskana gelten kann, wie ich in diesem Winter erneut feststellen musste, als ich am 09. April 2010 auf 1600 Meter Höhe vor einer völlig eingeschneiten Berghütte stand. Die Schneegrenze lag bei etwa 1400 Meter (Südosthang). Am 11. April schneite es bis herab auf etwa 1000 Meter. Und doch stehen auch in der "Pesciatiner Schweiz" bei Pistoia Olivenhaine.
In einem Bergdorf auf 650 Meter Höhe sah ich bei einer Wanderung eine an der Basis interessant eingepackte Olive (s. Foto). Aus Pescia, genauer: von der variantenreichen Baumschule SPO (Societa Pesciatina d'Orticoltura) habe ich mir dann vier Pflanzbäume von lokal frostbewährten Sorten (Bianchera und Leccio del Corno) im Fluggepäck mitgebracht, von denen sich Bianchera auch bei mir gut gehalten hat.
Zum ersten Mal fiel mir auf, wie wenig sich die Vegetation der Provence unterscheidet von der im Kraichgau, auch wenn die Bäume im Wuchs deutlich an größere Hitze und Trockenheit angepasst sind. Besonders freute ich mich über Karthäusernelken, die uns öfter begegnet sind. Die extreme Hitze in diesem Provence-Sommer (um die 40-Grad-Schwelle pendelnd) hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ich hoffe doch, dass uns ein solches Klima erspart bleibt. Untersuchungen zur Klimaerwärmung besagen allerdings auch, dass Südfrankreich von der Erwärmung besonders betroffen sei.
Olivenöl der Provence war selten zu bekommen - und wenn, dann zu äußerst heftigen Preisen. Dafür gab es Oliven aus Nyons (Sorte: Tanche) häufig. An den Geschmack musste ich mich erst gewöhnen, rauchig-harzig, an Thymian und Rosmarin erinnernd, ruppiger als die mir bekannten italienischen oder griechischen Speiseoliven oder die spanische Arbequina, die ich besonders mag.
Analogien zu den auf van Gogh-Bildern erkennbaren Anhäufungen um Olivenbäume, "monticules", entdeckte ich auch. Diese "monticules" seien, wie ich erfragen konnte, erst unlängst nach den Frösten des Winters 2008/09 angelegt worden! Die mir bekannte These, mit diesen Erdhügeln sollten Bodenaustriebe nach Frostschäden zurückgehalten werden, war bei diesen Beispielen wenig überzeugend. Es schien hier eher um Wurzel- und Basisschutz zu gehen. In den Erdhaufen befanden sich bereits junge Wurzeln, aus der bedeckten Stammbasis getrieben.
Gerühmt wird Nyons von Olivenenthusiasten für die Sorte Tanche, auch "Olive de Nyons" oder "Olive noir de Nyons" genannt, die ein aromenreiches Olivenöl AOP (das erste so zertifizierte in Frankreich) liefert und auch als Speiseolive geschätzt wird. Über 600 Hektar sind mit Tanche bepflanzt. Wobei ich im Gelände eine irritierende phänotypische Vielfalt sah, grob unterscheidbar in Pflanzen mit kleineren, bereits weitgehend geschwärzten Früchten, und Pflanzen mit größeren, noch durchgängig grünen Früchten. Mir wurde versichert, alles sei Tanche.

Das Olivenmuseum bietet den Bestand üblicher Heimatmuseen, altes Olivenbauerngerät, Mühlsteine etc. pp. Die Mitarbeiter der Verkaufsräume können einem weiter gehenden Informationsbedürfnis eher nicht aufhelfen, die gut sortierte Buchhandlung bei der Place de la Libération kann dies, mit ausgezeichneten Publikationen zum Olivenanbau in Frankreich.
Lehrreich war die Fahrt vor allem durch die Bekanntschaft mit einem breiten Spektrum an Olivenbäumen unterschiedlichen Alters, von denen zahlreiche offensichtlich den Extremfrost Anfang 1956 überstanden hatten, andere zeigten Neuaustriebe von 1956ff und 1985ff. Dazu fand ich reichlich Anschauungsmaterial zur Gestaltung der "plantation en butte", der "monticules" für den Olivenbaum. In einigen Hainen sah ich Steinanschüttungen an der Stammbasis. Olivenhaine gab es bis in eine Höhe von etwa 600 Metern. Auf dem Foto rechts ist zu sehen ein Hain bei Villeperdrix, auf einer Höhe von 471 Metern, mitten in den Bergen.
Scharf ins Bewußtsein getreten ist mir auch, was üblicherweise bei Passagen über den Brennerpass oder durch den Gotthardtunnel erfahrbar wird: Wo der Süden für uns wirklich anfängt. Im frühen Herbst ist der Unterschied deutlich spürbar. Etwa auf der Höhe von Valence passierte es. Und beim Ausstieg aus dem Zug in Montelimar wußten wir es: Wir sind im Süden, jetzt erst. Die Vegetation, die Luft, das Licht, die Gerüche. Da hatte ein qualitativer Sprung stattgefunden.
Süddeutsche Weinbaulagen, der Kaiserstuhl, der Michaelsberg und ähnliche Ausnahmelagen können im Sommer mithalten. Im Herbst aber zeigt sich, warum bei uns eben auch in naher Zukunft im Freiland Olivenbäume nicht wirklich gut gedeihen oder gar fruchten können. Zu viel Feuchtigkeit bei zu wenig Wärme. Künftig werde ich die Pflanzung auf Monticules/Buttes erproben, mit Steineinlagerungen (wir haben ja Kalkstein zuhauf).
 Verkehrsmitteln ist
die Reise sehr beschwerlich. Bis zu sieben mal umsteigen
(Bahn und Bus), letztes Wegstück Taxi, damit muss man aus
Deutschland kommend rechnen, wenn man Siena oder Orvieto
"mitnehmen" möchte. Einfacher ist die Anreise über das
weniger spektakuläre Grosseto.
Verkehrsmitteln ist
die Reise sehr beschwerlich. Bis zu sieben mal umsteigen
(Bahn und Bus), letztes Wegstück Taxi, damit muss man aus
Deutschland kommend rechnen, wenn man Siena oder Orvieto
"mitnehmen" möchte. Einfacher ist die Anreise über das
weniger spektakuläre Grosseto. Am Monte Amiata lag noch Schnee, selbst an den Südhängen bis herab auf etwa 1300 Meter. Phänologisch befanden sich die Olivenhaine in der Entwicklung mindestens eine Woche hinter dem meinen. Für den vergangenen Winter wurde mir von -14 Grad Tiefsttemperatur berichtet. Allerdings verzeichnet die Wetterstation der ARSIA lediglich -10 Grad als Spitzenwert. Aus Umbrien wurden am 28.02.2018 gleichfalls zweistellige Frostgrade in Olivenregionen gemeldet. Bei uns waren es in Rheinstetten dokumentierte -12 Grad Tiefsttemperatur am 28. Februar. Eistage gab es in Seggiano laut ARSIA 2, bei uns 3.
Im Herkunftsgebiet fällt Olivastra, wie die Varietät hier kurz heißt, durch ihre Größe und das intensiv dunkelgrüne Laub auf. Das Foto zeigt ein besonders altes Exemplar in der Nähe einer etruskischen Tempelanlage (42.56.15-N 11.33.52-E). Ein weiteres beeindruckendes Exemplar sah ich auf 856 Meter Höhe an den nordwestlichen Ausläufern des Monte Amiata, beim ersten Hof oberhalb von Pescina (42.55.06-N 11.35.37-E). Die Varietät gilt als "weiblich", womit gemeint ist, dass sie wenige Pollen produziert und eine "männliche" Sorte zur Befruchtung benötigt. Dafür werden die "maschii" Leccino, Moraiolo und Pendolino gepflanzt - erkennbar an geringerem Wuchs, hellerem Laub und teilweise erheblichen Frostschäden des vergangenen Winters. Die Olivastra-Bestände bei Seggiano dagegen haben überwiegend sogar den für die Toskana verheerenden Frost von Januar/Februar 1985 überlebt!
Auch am Monte Amiata stieß ich, wie schon in Frankreich, auf die erhöhte Pflanzung (frz. "en butte") alter Olivenbäume. Allerdings fand ich niemanden, der mir dies als absichtsvolle Maßnahme bestätigen konnte. Ein alter Kleinbauer gab mir im Gespräch den Hinweis auf eine dritte Funktion der erhöhten Pflanzung mit Steineinlagerung (neben den mir schon früher, in Nyons, genannten Funktionen Nässeschutz für die Wurzeln und Frostschutz), nämlich größere Trockenheitsresistenz zu erzielen durch tiefer reichende Wurzeln.
Die Vegetation in den Olivenhainen war mir ganz vertraut aus dem Kraichgau. Aufgefallen sind mir vor allem die zahlreichen Wiesenknöpfe (auf kalkreichen, lehmigen, warmen, mageren Böden) und die Weinbergsträubl/Traubenhyazinthen (auf kalkreichen, warmen, lehmigen Böden) in traditionell gepflegten Anlagen. Allerdings gibt es bereits zahlreich auch die durch Überdüngung und/oder häufigen Schnitt grob verarmten Graswiesen.
 und andere
albanische Forscher vertreten die Auffassung, dass
Olivenbestände einen essentiellen Teil der illyrischen
Kultur ausmachten und dass möglicherweise die Illyrer die
ersten waren, die Oliven aus Wildbeständen kultivierten
(Ismaili/Gixhari/Sulovari, The Origin of the Olive in
Albania, rep. 03/2018). Der Nationalheld Albaniens, der im
15. Jahrhundert die osmanische Herrschaft aus Albanien
vertrieb, Gjergj Kastrioti, genannt Skanderbeg, erließ um
das Jahr 1450 ein Gesetz, wonach nur heiraten durfte, wer
zuvor 10 Olivenbäume gepflanzt hatte. Und auch in der
Gegenwart spielen Oliven eine bedeutsame Rolle, insbesondere
als Speiseoliven, die auf allen Märkten zu finden sind.
und andere
albanische Forscher vertreten die Auffassung, dass
Olivenbestände einen essentiellen Teil der illyrischen
Kultur ausmachten und dass möglicherweise die Illyrer die
ersten waren, die Oliven aus Wildbeständen kultivierten
(Ismaili/Gixhari/Sulovari, The Origin of the Olive in
Albania, rep. 03/2018). Der Nationalheld Albaniens, der im
15. Jahrhundert die osmanische Herrschaft aus Albanien
vertrieb, Gjergj Kastrioti, genannt Skanderbeg, erließ um
das Jahr 1450 ein Gesetz, wonach nur heiraten durfte, wer
zuvor 10 Olivenbäume gepflanzt hatte. Und auch in der
Gegenwart spielen Oliven eine bedeutsame Rolle, insbesondere
als Speiseoliven, die auf allen Märkten zu finden sind.Dass die ältesten Olivenbestände Albaniens sich meist in der Nähe von Burganlagen finden lassen, die in der albanischen Geschichtsschreibung den Illyrern zugeschrieben werden, ist auffallend, aber auch topographisch und historisch wenig erstaunlich. Häufig (wie etwa in Kanina belegt) befand sich dort schon eine Siedlung, ehe die Burg (in Kanina zur Abwehr römischer Expansion im 3. Jahrhundert v. Chr.) errichtet wurde. Allerdings ist nicht belegt, ob die ältesten albanischen Olivenbestände schon von Illyrern oder erst später von griechischen Kolonisten angelegt wurden. Die in Albanien häufigste Olivensorte Kalinjot dürfte ihren Ursprung im Gebiet Kanina haben, sie wird auch "Kanine" oder "Kaninjot" genannt.
Ältere Oliven stehen in Albanien - wie auch in Frankreich und andernorts im Mittelmeerraum - bisweilen auf eigenen kleinen Terrassierungen, gelegentlich auch darauf nochmals erhöht. Oberhalb von Vlora, einer Hafenstadt im Süden Albaniens und Zentrum der Olivenölproduktion, entdeckte ich bei Kanina an einem Südhang eine Olivenanlage mit neu angelegten Mulden zum Hang hin hinter den Olivenbäumen. Offensichtlich sollten diese Mulden das talwärtige Abfließen von Regen- oder Gießwasser verhindern und als Regenwassersammler fungieren.
Die Zukunft der ehrwürdigen albanischen Olivenbestände wird vermutlich ganz vom Tourismus abhängen, falls das ökologische und das historisch-kulturelle Interesse sich nicht auch in substantiellen öffentlich-politischen Schutzmaßnahmen artikuliert. Wovon bislang (Stand 2025) nichts zu erfahren ist. Bei der Olivenölproduktion wird allerdings auf Qualität gesetzt, wie das Zentrum für den Transfer landwirtschaftlicher Technologien in Vlora 2024 mitteilte - und das lässt schon mal hoffen.

Bei Montebenichi (508 Meter über Meer), dem in der Literatur als Herkunft für Morchiaio genannten Ort, fand ich leider keine eindeutig identifizierbaren Exemplare dieser Sorte, ein sehr schönes älteres Exemplar entdeckte ich unterwegs auf einer Höhe von ca. 310 Metern. Was vor allem daran lag, dass ein sehr umfangreiches Gebiet mit vielversprechenden Olivenhainen nahe bei Montebenichi vollständig umzäunt war, mit Sichtschutz und zusätzlichem inneren Elektrozaun um den Kernbereich - am Einfahrtstor war dieser zu sehen, mit Warnschild! Diese Haine kenne ich daher nur aus den Luftbildern von Google Earth. Ein zweiter Versuch, Montebenichi und dort andere Haine zu erreichen, scheiterte an einem massiven Gewitter mit nachfolgendem Dauerregen. Der älteste Olivenbaum der Region, der Olivone di Montebenechi mit einem vermuteten Alter von über 300 Jahren, stammt von einer unbestimmten Sorte.
Vorbei an der Skyline von Assisi und dem gleichfalls höchst beeindruckenden Spello kam ich nach einem scharfen Knick der Bahnlinie nach Gualdo Tadino im benachbarten Umbrien, wo gerade die "Giochi de le Porte" vorbereitet wurden, was der Stadt ein festliches Gepräge gab, mit Fahnen der vier Stadtteile an vielen Häusern. Mich interessierte allerdings weit mehr die auch als frosthart gerühmte Olivensorte "Nostrale di Rigali", die aus einem Vorort von Gualdo Tadino, Rigali, stammt. Mit freundlicher Unterstützung durch die Betreiberin eines Elektronikfachgeschäftes kam ich zu einer höchst erfreulichen Begegnung mit dem sachkundigen, ideenreichen und engagierten Mitinhaber des Familienbetriebes Maximus aus Rigali, Samuele Gramaccia. Seine Familie besitzt etwa 2000 Olivenbäume überwiegend der Sorte Nostrale di Rigali, gestreut in einem Band zwischen 530 und 660 Metern Höhe, und nimmt immer wieder weitere kleine aufgegebene Olivenhaine in Pflege, die sie nach ökologischen Anbauregeln wiederbelebt. Die Familie trägt damit erheblich zum Landschaftsbild und zur Biodiversität ihrer Region bei. Ihr sortenreines, exzellent mundendes Nostrale-Öl wurde bereits von Slow Food gewürdigt. Der junge Olivenbewahrer zeigte mir auch einige besonders alte Bäume, die schon zwei Extremfröste (1956, 1985) und eventuell schon den von 1929 überlebt haben (s. Foto rechts) und berichtete, das hohle Innere dieser Bäume sei von seinen Vorfahren immer wieder gereinigt worden, bis in den abgestorbenen Wurzelbereich. Eine genaue Altersbestimmung dürfte daher unmöglich sein.
Samuele bestätigte mir, was ich schon aus der Literatur wusste, dass Nostrale recht anfällig gegen Pilzkrankheiten und Befall durch die Olivenfliege sei. Ich hatte von Nostrale di Rigali 2009 ein Exemplar zur Beobachtung, das ich aber wegen des starken Befalls mit Occhio di Pavone weitergegeben habe, um eine breite Infektion in meiner neu aufgebauten und durch Fröste bereits belasteten Anlage zu vermeiden.
Die Olivenhaine oberhalb von Gualdo Tadino ziehen sich Richtung Valsorda bis in eine Höhe von 760 Metern, neben Nostrale sind noch andere Sorten beteiligt, ich fand unter anderem Moraiolo und Orbetana. Wobei mich in einem besonders hoch gelegenen Hain vor allem Orbetana beeindruckte mit auffallend gesundem Laub und zahlreichen intakten, tiefgrünen Früchten. Der gut informierter Hainbesitzer war gerade vor Ort und er legte mir diese Sorte besonders ans Herz, er kannte sie unter dem Namen "Marchigiana" - "die aus den Marken". Er bekannte allerdings auch, intensiv Schutzmittel einzusetzen - und ein Mittel gegen die Verrieselung im frühesten Fruchtstadium. Gegen Pilzkrankheiten und zur Stärkung für den Winter setzt er, wie viele Olivenanbauer, wohl die meisten, Kupfer ein. Das Stichwort "Bordeauxbrühe" fiel, nicht nur bei ihm. Was ich zudem fand nahe beim oberen Stadtrand von Gualdo Tadino waren Olivenbäume von weit über 100 Jahren Alter auf einer Höhe von 597 Metern, Südwesthang, die auf kleinen eigenen Plattformen standen, die hangabwärts mit Steinmauern eingefasst waren. Das kenne ich so auch aus Griechenland und Albanien. Waren die Plattformen angelegt für die ehrwürdig alten Bäume - oder konnten die Bäume so alt werden, da sie diese Plattformen hatten, die z.B. das oberflächliche Abfließen des Wassers reduzieren, ebenso aber auch Staunässe (was Oliven gar nicht vertragen) - und die dazu noch Humus sammeln!?
Zum Abschluss, es war schon Anfang Oktober, besuchte ich Ascoli Piceno in den Marken, eine äußerst beeindruckende Stadt am Rand der Abruzzen, die sich neben den vielbesuchten großen Namen der Toskana und Umbriens nicht verbergen muss! Die berühmte widerstandsfähige Sorte hier heißt Ascolana tenera und liefert die Grundlage für die schmackhaften gefüllten und panierten "Olive Ascolane". Die Sorte fand ich bis in eine Höhe von 480 Metern bei der Ortschaft Montalto delle Marche. Auffallend war ihre äußerst kompakte Krone, die nach unten den Stamm häufig geradezu einhüllte. Von Ascolana habe ich seit 2009 sieben Exemplare verschiedener Herkünfte gepflanzt, drei leben noch, zwei von 2012 (Flora Toskana) ganz stabil, eine von 2014 (SPO Pistoia) sehr schwächlich. Nach den Früchten bin ich mir nicht sicher, ob ich da "tenera" habe. Es gibt, offenkundig auch bei Ascoli, zwei unterschiedliche Varietäten, "tenera" und "dura". Als "Ascolana" wurden mir sowohl Bäume mit sehr großen, noch grünen Früchten gezeigt, als auch Bäume mit mittelgroßen bis kleinen, teilweise schon schwarzen Früchten. Frosthärter ist "tenera", in meinen Lieferrechnungen finde ich allerdings nur die Angabe "Ascolana"! Also aufgepasst, wenn Sie in Deutschland Ascolana pflanzen wollen, dass Sie wirklich "tenera" bekommen!
Obgleich vor Ort die Sorte als bereits im Mittelalter, nach einer belletristischen Quelle gar schon zu Kleopatras Zeiten, bekannt gewesen sei, konnte ich nur Exemplare mit maximal einem Alter zwischen 70 und 80 Jahren finden (laut Angaben von Einheimischen). Und niemand (auch nicht im Fremdenverkehrsbüro) konnte mir den Standort eines "ältesten" Ascolana-Baumes nennen. Entweder ist die Sorte jüngeren Ursprungs - oder aber die doch häufig strenge Witterung hier, nicht nur mit Frost, sondern auch mit Starkwind, lässt die Bäume nicht älter werden. Ganz erstaunlich fand ich die Extremheit der Lagen, in denen ich Ascolana tenera fand. Bei Montalto hat mich der Wind fast vom Fahrrad geblasen. Und in Ascoli stehen Bäume an den Hängen des Flusses Tronto, teilweise an einem Nordhang, noch zusätzlich abgeschattet durch hochgewachsene Laubbäume. Das sortenreine Öl aus der Ascolana tenera-Olive ist von eher mildem Geschmack - ich konnte allerdings nur das aus tieferen Lagen verkosten.
Die Reise war insgesamt sehr lehrreich, hat meinen Olivenanbau-Horizont erheblich erweitert. Betrüblich war es, viele aufgelassene Olivenhaine zu sehen. Verschiedentlich wurde mir berichtet, dass der Olivenanbau seit einigen Jahren erheblich unter Klimaproblemen zu leiden habe. Samuele nannte konkret das Jahr 2008, seitdem habe man immer wieder mit unzeitiger Kühle, mit Trockenheit, mit hoher Feuchtigkeit und entsprechenden Pilzinfektionen, und schließlich auch mit der Olivenfliege zu kämpfen. Ähnliches hörte ich auch von anderen Olivenbauern, etwa bei Montozzi. 2008 war das Jahr, in welchem ich mit meinem Experiment begonnen habe - um gleich darauf vier äußerst strenge Winter mit meinem jungen Hain zu erleben. In Ascoli Piceno gab es 2012 einen großen Frost, 2016 das schwere Erdbeben mit einem Nachbeben 2017, und im Januar 2017 schneite es mit extremer Heftigkeit und Fülle im ganzen Piceno. "Zwei Jahre wie aus einem Katastrophenfilm", so ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung. In vielen Hainen hatte bei meiner Reise die Ernte schon begonnen - unter anderem als Reaktion auf den Befall durch die Olivenfliege, kurz "mosca" genannt. Denn wenn die Maden erstmal entwickelt sind, sind die Früchte verloren.
***